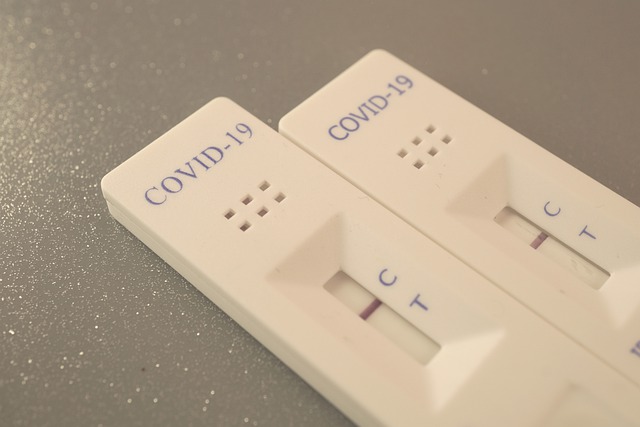Öko-Strom ist kein Nischenprodukt mehr. Das ist eine gute Nachricht für jeden, der den Klimawandel als ernste Gefahr betrachtet. Wenn es um den Kampf gegen den Klimawandel geht, kommt es auf jeden Einzelnen an. Denn viel hängt davon ab, wie wir unseren Energiebedarf künftig decken.
Das heißt aber nicht, dass jeder eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach installieren kann oder möchte. Denn zum Glück gibt es ja in Deutschland gut 1.300 Stromanbieter, und viele davon mit einem oder mehreren Öko-Tarifen. Schon heute nutzt fast die Hälfte (45 Prozent) der Menschen in Deutschland zwischen 20 und 50 Jahren nach eigenen Angaben zu Hause ausschließlich Ökostrom.
Dieses Ergebnis basiert auf einer forsa-Umfrage im Auftrag von Direktversicherer CosmosDirekt. Weitere 36 Prozent würden künftig gerne komplett auf nachhaltige Stromquellen setzen. Für nur gut jeden Zehnten (13 Prozent) kommt grüner Strom aus der Steckdose eher nicht in Frage.
Lars Wallerang / glp