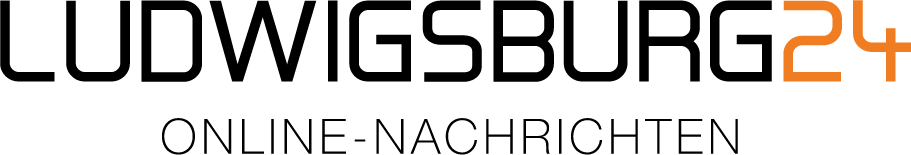Rund 1.100 eigene, tonnenschwere LKWs des Kornwestheimer Familienunternehmens GV Trucknet (Große-Vehne) rollen unter verschiedenen Firmennamen durch Deutschland und Europa. Ihr Auftrag: Die Ware von namhaften Kunden aus den Bereichen Automotive, Systemverkehre, Papier, Textil und Lebensmittel sicher zum Verbraucher zu bringen.
„Neben dem großen Fuhrpark und rund 90.000 m² Lager- und Umschlagsflächen sorgen unsere rund 2.500 Mitarbeiter – davon die meisten auf dem LKW, die anderen an unseren acht Standorten – für einen reibungslosen Ablauf“, berichtet Geschäftsführer René Große-Vehne im Gespräch mit LUDWIGSBURG24. Auch gewährt der 47-jährige Betriebswirt Einblicke in seine Firmenphilosophie, spricht über seine unternehmerische Verantwortung für die Gesellschaft und gibt einen Ausblick in die Zukunft.
Ein Interview von Patricia Leßnerkraus und Ayhan Güneş
Ludwigsburg24: Herr Große-Vehne, weder Sie selbst noch Ihr Name klingen schwäbisch…
GV: Richtig, ursprünglich komme ich aus Westfalen. Dort hatte mein Opa den Betrieb gegründet, den mein Onkel übernahm und den heute der Mann meiner Cousine leitet. Mein Vater ist Schlosser und Ingenieur geworden, ist zur DEKRA gegangen und deshalb sind wir hier in den Stuttgarter Raum gekommen.
Gehören Sie denn mit der Spedition Große-Vehne im Münsterland zusammen?
Nein, die Unternehmen sind absolut eigenständig und in ganz anderen Branchen tätig. Wir fahren zum Beispiel im Automobil-, im Textil-, im Getränke- und auch im Paket-, Express- und Kurier-Bereich, also für Hermes, DHL, GLS, DPD oder UPS die lange Strecke. Wir sind aber immer noch freundschaftlich, verwandtschaftlich verbunden, haben ein gutes Verhältnis, treffen uns regelmäßig und feiern gerne auch miteinander Feste.
Wenn Ihr Vater bei der DEKRA war, wie kommt es dann zu Ihrer Spedition, die es ja bereits ebenfalls schon seit 1974 gibt?
1974 kauften meine Eltern ihren ersten LKW, der bei meinem Onkel mitgefahren ist. 1991 haben sie sich dann dazu entschieden, Große-Vehne in Stuttgart zu gründen. Ein externer Geschäftsführer hat sich zusammen mit meiner Mutter um die Spedition gekümmert, mein Vater hat die beiden unterstützt.
Wann sind Sie dazu gestoßen?
Schon als Schüler und später als Student habe ich in den Semesterferien mitgearbeitet in allen Bereichen, habe vom Büro übers Lager alles gemacht. Meinen Eltern war es wichtig, dass ich alles lerne. Manchmal habe ich nachts um halb vier angefangen und einen LKW mit Reifen ausgeladen, bin dann um halb sieben ins Büro und habe bis abends dort disponiert. Ich bin sogar LKW gefahren, allerdings nur im Nahverkehr. Dafür wurde ich zwar gut entlohnt, aber es war schon eine anstrengende Zeit.
Fest ins Unternehmen eingestiegen bin ich 2005 im Alter von 30 Jahren. Damals habe ich nach meinem Betriebswirtschaftsstudium in Münster bei der Firma „hsv Systemverkehre“ angefangen, die auch zu GV Trucknet gehört. 2007/2008 bin ich als Geschäftsführer an den Stammsitz hier gekommen und in meine Gesamtführungsaufgaben mit Unterstützung meines Vaters hineingewachsen.
Sie haben tatsächlich den LKW-Führerschein?
Als das Unternehmen 1991 gegründet wurde, durfte ich zwar noch nicht fahren, aber einer unserer ersten Mitarbeiter sagte irgendwann: „Ich stelle dir die LKWs zum Waschen nicht mehr hin, du holst sie dir selbst.“ Ab da durfte ich als Sechzehnjähriger auf dem Hof die LKWs fahren. Der Mitarbeiter hat mir alles Nötige beigebracht, zum Beispiel wie man die Lafette unter eine Wechselbrücke setzt. Vor kurzem habe ich es noch einmal probiert, doch ich kann es leider nicht mehr – mir fehlt einfach die Übung.
Hat es Ihnen Spaß gemacht, mit dem LKW zu fahren?
Ja, klar, ich habe generell Freude an Fahrzeugen. Mir gefällt das Geräusch eines LKWs, ich mag auch das Geräusch eines Dieselmotors.
Sie sprachen eben davon, dass Sie für den Paketbereich fahren. Sind Sie verantwortlich für die Same-Day-Lieferungen, wie sie beispielsweise Amazon verspricht?
Nein, damit haben wir gar nichts zu tun, das regelt Amazon selbst. Ob diese prompte Lieferung generell für alle Anbieter Einzug bei uns hält, entscheiden allein die Verbraucher. Wenn Sie mich persönlich fragen, sage ich Ihnen klar: Ich brauche meine Bestellung nicht schon am selben Tag.
Sollte die Gesellschaft das aber so wünschen, werden auch wir selbstverständlich überlegen, wie wir diesen Wunsch erfüllen können. Wir versuchen immer, die Anforderungen und Bedürfnisse unserer Kunden mitzugestalten, damit wir als Unternehmen mit in die Zukunft gehen. Deshalb beschäftigen wir uns im Automobilbereich beispielsweise intensiv mit Themen wie Batterie-Transport und Lagerung.
Ein Grundsatz Ihres Unternehmens lautet: „GV GOES ZERO“. Jetzt reden wir von einer Spedition, die Ware von A nach B bringt. Deswegen ist es eher ungewöhnlich für ein Unternehmen, dass es sich so etwas auf die Fahne schreibt.
Mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen wir uns schon lange. Bereits 2009 haben wir Gespräche mit dem „Zentrum für nachhaltige Unternehmensführung“ (ZNU) an der Universität Witten-Herdecke aufgenommen und eine intensive Zusammenarbeit als Partner des Instituts begonnen. Darauf basierend entstand 2017 die Initiative „ZNU GOES ZERO“.
Das gesetzte Ziel: bis 2023 müssen alle Mitgliedsunternehmen der ZNU CO2-neutral sein. Der Grundsatz dabei ist: so viele Emissionen wie möglich zu vermeiden, was nicht zu vermeiden ist, wird bestmöglich reduziert. Alles, was nicht vermieden oder reduziert werden kann, wird kompensiert. 2018 haben wir gemeinsam mit einigen anderen Unternehmen wie beispielsweise der Brauerei Bitburger oder dem Stuttgarter Gemüsering entschieden: Wir machen das, und zwar sofort.
Unser Unternehmen braucht kein Marketing-Budget, deshalb haben wir mit allen Geschäftsführern gemeinsam und einstimmig entschieden, das Geld, das andere in Werbebudgets stecken, in Bäumen anzulegen und lassen über „Plant for the Planet“ in Mexiko, genauer gesagt auf der Halbinsel Yucatan, Bäume anpflanzen.
Warum pflanzen Sie die Bäume gerade in Mexiko und nicht in Deutschland und über wie viele Bäume reden wir?
Jährlich werden von unserem Beitrag rund 200.000 Bäume gepflanzt. Würden wir die Bäume in Deutschland pflanzen, würde es uns schätzungsweise das Zehnfache kosten. Außerdem ist der Regenwald in Mexiko die Lunge der Welt.
Die Bewaldung können wir über Satelliten genau verfolgen. Hinter „Plant for the Planet“ steht Felix Finkbeiner, ein beeindruckender junger Mann, der die Initiative schon im Alter von gerade einmal neun Jahren ins Leben gerufen hat.
Waren Sie selbst schon mal dort und haben Ihre Bäume begutachtet?
Ich hatte schon oft mit dem Gedanken gespielt, aber dann kam Corona dazwischen. Ich hoffe, das sich bald ein Besuch realisieren lässt.
Erwarten Kunden heutzutage Nachhaltigkeit von einem Unternehmen?
Als wir unseren CO2-Fußabdruck 2018 auf null gesetzt haben, hat es, gelinde gesagt, niemanden interessiert. 2020/21 hat das Ganze dann Fahrt aufgenommen. Wir werden unsere Nachhaltigkeit jetzt auch offiziell zertifizieren lassen.
Wir versuchen immer einen Schritt vorauszudenken. Mit dem Thema Nachhaltigkeit haben wir jetzt dreizehn Jahre Erfahrung gesammelt. Seit drei Jahren gibt es ein festes Nachhaltigkeitsteam im Unternehmen – sukzessive verankern wir das Thema Nachhaltigkeit tiefer und breiter im Unternehmen.
Irgendwann wird der Kunde die Nachhaltigkeit bei Dienstleistern und Partnern voraussetzen. Wir müssen an die Generationen nach uns denken, an die wir unsere Welt übergeben. Wir beschäftigen uns intensiv mit der Forschung nach unweltfreundlicheren Alternativen. Durch Versuche mit alternativen Antrieben sammeln wir wichtige Erfahrungen. Zum Beispiel bringen wir mit dem Reallabor Hylix-B, unterstützt vom Landesumweltministerium, im März 2022 einen Wasserstoff-LKW auf die Straße.
Meine Devise und Motivation, auch für die nächste Generation, lautet: Nicht andere machen lassen, sondern selbst anpacken und sich weiterentwickeln. Das funktioniert aber nur, wenn alle Mitarbeiter im Unternehmen auch davon überzeugt sind und mitziehen.
Vor zwei Jahren hat Corona die Welt verändert. Inwiefern hat die Pandemie auch Ihr Unternehmen beeinflusst. Sind Sie ein Gewinner oder Verlierer der Krise?
Für ein Logistikunternehmen kommt es darauf an, wie es dem Kunden geht, allein davon sind wir abhängig. Nehmen wir den Textilbereich, da fahren wir für den Einzelhandel. Der stationäre Handel hatte während des Lockdowns geschlossen. Das führt dazu, dass die LKWs genauso stehen.
Gleiches galt für die Werke der Automobilbranche, die ebenso stillstanden. Die Halbleiterkrise hat auch ihren Teil beigetragen. Es war eine Situation, die uns nicht zu den Gewinnern der Krise macht, aber auch nicht zu den Verlierern.
Gibt es andere Sorgen, die Sie umtreiben?
Der Logistikbranche fehlt Nachwuchs, weshalb wir verstärkt ausbilden. Hier am Standort Kornwestheim haben wir 80 Auszubildende, davon werden fast 60 als Fahrer ausgebildet, der Rest verteilt sich auf die Bereiche Büro, Werkstatt und Lager. Im vergangenen Jahr kam noch der IT-Bereich dazu.
Es mag altmodisch klingen, doch ich finde es spricht nichts gegen die Einstellung „von der Lehre bis zur Rente“. Entwickeln können wir uns nur mit Menschen, die sich dem Unternehmen verbunden fühlen. Nehmen wir nur die älteren Fahrer, die mich schon lange kennen und die, wenn ich keine Telefonate habe, in mein Zimmer kommen, um spontan einen Kaffee mit mir zu trinken. Aber auch junge Mitarbeiter finden bei uns immer ein offenes Ohr. Reden ist wichtig, so kann man auch über Probleme sprechen, sie gemeinsam angehen und lösen bevor es zu Konflikten kommt.
Sie sind also ein Chef zum Anfassen…
Wir sind ein Unternehmen mit flachen Hierarchien. Ich selbst komme mit Freude zur Arbeit, das wünsche ich mir ebenso für die Mitarbeiter. Egal in welcher Branche – wenn einem Menschen dauerhaft bei der Arbeit die Freude fehlt, dann sollte er lieber seinen Job wechseln.
In Deutschland fehlen 60.000 bis 80.000 Berufskraftfahrer. Wozu das führen kann, hat man kürzlich in England gesehen. Wie finden Sie neue Fahrer?
Vieles läuft über Mund-zu-Mund-Propaganda. Auch unser Ausbildungsleiter, Alexander Koch macht mit seinem Team einen großartigen Job. Sie kümmern sich um die Menschen. Es ist wichtig, dass man jedem Mitarbeiter vermittelt: „Du bist ein ganz wichtiger Bestandteil des Unternehmens und der Gesellschaft.“
Ich würde mir wünschen, dass gerade auch die Fahrer von der Öffentlichkeit mehr Wertschätzung erfahren. Da ich das aber nicht von der Gesellschaft erwarten kann, muss ich selbst damit anfangen. Deshalb erkläre ich schon jedem neuen Lehrling, dass ohne ihn kein Daimler vom Band geht oder kein Paket Stuttgart verlässt. Das vermittelt allen Mitarbeitern Stolz und das Selbstvertrauen, dass sie einen wertvollen sowie zukunftsorientierten Job haben.
Gibt es sonst noch irgendwelche Besonderheiten für das Personal?
Wir versuchen unsere Wertschätzung zudem durch kleine Geschenke zu Weihnachten, durch schöne Feste im Sommer und zu Weihnachten oder durch andere kleine Gesten auszudrücken.
Dinge, wie ein einfaches Danke, echtes und ehrliches Interesse am Menschen, gegenseitiger Respekt, Ehrlichkeit, Offenheit und Fairness – das ist viel wert. Und ich bin sehr stolz, dass uns diese Werte als Familienunternehmen prägen und wir sie jeden Tag versuchen zu leben.
Könnte hier das Gleiche passieren wie in England, dass plötzlich nichts mehr geht, weil die Fahrer fehlen?
Natürlich, ist auch hier nicht von der Hand zu weisen, dass das kurz- bis mittelfristig ebenfalls droht. Wenn die Engländer ihre Tore länger als vier Monate aufgemacht hätten, dann wäre ich sehr gespannt gewesen, was hier passiert. Wir sind doch ebenso wie die Engländer neben den heimischen Mitarbeitern auch vom osteuropäischen Mitarbeiter-Markt abhängig.
Dadurch, dass England sich abgegrenzt hat, sind viele polnischen Fahrer wieder nach Deutschland zurückgekommen. Hätte England allerdings wieder aufgemacht und die prognostizierten Löhne bezahlt, dann wären wahrscheinlich auf einen Schlag 20.000 bis 30.000 Fahrer von hier weggegangen. Stellen Sie sich das mal vor mitten im Weihnachtsgeschäft.
Dazu kommt die Altersstruktur der Fahrer. Wenn nicht genügend Nachwuchs heranwächst, dann erhöht sich die Zahl der bis zu 80.000 fehlenden Fahrer jährlich um etwa 15.000.
Aber wo genau liegt das Problem, dass keiner mehr diesen Beruf ausüben will? Liegt es an der Bezahlung?
Die Bezahlung ist eigentlich besser als viele denken und entwickelt sich stetig. Dennoch verlieren wir Mitarbeiter vor allem an die große Industrie wie Daimler, Porsche, Bosch. Aber das ist nicht nur in unserer Branche so, beispielsweise das Handwerk ist genauso betroffen.
Dazu kommt, dass die Bundeswehr nicht mehr ausbildet. Von dort kamen früher extrem viele Mitarbeiter in die Unternehmen. Nachdem das weggefallen ist, bildet kaum jemand mehr aus. Die großen Logistik-Unternehmen wie DHL oder Schenker haben keine eigenen LKWs, sondern arbeiten mit kleineren Unternehmern. Diese bilden ebenfalls nicht aus, weil sie fürchten, dass sie das Geld in die Ausbildung investieren und der Fahrer danach zu einem anderen Arbeitgeber wechselt.
Die Struktur stimmt einfach nicht, deshalb müssen wir uns selbst dem Problem annehmen. Während der Flüchtlingskrise haben wir zum Beispiel eng mit Flüchtlingsheimen zusammengearbeitet.
Inwiefern?
Flüchtlinge durften hier bis zu sechs Wochen im Betrieb probearbeiten. Das war von der Ausländerbehörde genehmigt und wurde vom Arbeitsamt finanziert. Ausgenommen war der Bereich der Berufskraftfahrer, weil sich Flüchtlinge nicht über die Landesgrenzen hinausbewegen dürfen.
Nach Ablauf der sechs Wochen mussten alle Beteiligten entscheiden, ob es gemeinsam in die Zukunft geht. Waren sich beide Seiten einig, wurden die Betreffenden anschließend fest angestellt. Dadurch haben wir ganz viele tolle Mitarbeiter für unser Unternehmen gewonnen.
Spielt bei der Nachwuchsproblematik eventuell auch das Thema autonomes Fahren eine Rolle?
Natürlich ist das ein Thema, denn es wird irgendwann kommen. Aber das heißt nicht, dass niemand mehr auf dem LKW sitzen wird. Der Fahrer bleibt wichtig, da es immer jemanden geben muss, der sich um die Be- und Entladung sowie die Ladungssicherung kümmert.
In Städten oder auf Baustellen wird sich das autonome Fahren nach heutigem Stand so schnell ebenfalls nicht umsetzen lassen. Das klappt auf längeren Strecken, aber schon bei einer Ausfahrt fängt es an schwierig zu werden.
Sicherheit im Straßenverkehr ist ein Thema, für das Sie sich stark machen. Vor ein paar Wochen haben Sie mit der Landesverkehrswacht ein neues Projekt ins Leben gerufen…
Verkehr ist ein Miteinander und der LKW wird oftmals als Feindbild wahrgenommen. Deshalb haben wir in Kooperation mit der Landesverkehrswacht einige Trailerheckportale mit Grafiken beklebt, die wichtige Themen ansprechen, die zu mehr Verkehrssicherheit beitragen.
Auf Trailern, die vorwiegend auf der Autobahn fahren, machen wir auf das Bilden einer Rettungsgasse aufmerksam. Denn wenn ein Unfall passiert, muss es für die Rettungskräfte schnell gehen. Bei den Trailern, die eher im städtischen Raum unterwegs sind, geht es um den Sicherheitsabstand zu Radfahrern. Hier wollen wir das Bewusstsein schärfen, für mehr Verständnis füreinander werben und den Verkehrsteilnehmern ein wenig die Angst nehmen vor dem vermeintlichen Ungeheuer LKW.
Ich bin außerdem dafür, jeden PKW-Fahrschüler eine Stunde in einem LKW mitfahren zu lassen, damit PKW-Fahrer ein Gespür dafür bekommen, welchen Radius der LKW-Fahrer überhaupt sieht.
Ein anderes Problem sind leere LKWs, vor allem in Baustellen. Die wenigsten Menschen wissen, dass ein leerer LKW schon mal 20 cm springt, wenn er eine Windböe abbekommt. Mit diesem Wissen würde sich so manche gefährliche Situation im Straßenverkehr vielleicht vermeiden lassen.

Unfälle mit dem LKW – können Sie uns sagen, wie viele Sie pro Jahr haben?
Wir haben jährlich zwischen 600 und 700 Kleinunfällen, bei denen mal ein Spiegel abbricht oder ein Lackschaden entsteht. Schwere Unfälle mit großen Schäden oder bei denen sogar Personen betroffen sind, kommen zum Glück nur ein- bis zweimal im Jahr vor.
Wir haben seit zwölf Jahren alle Fahrzeuge mit Safety-Packages ausgestattet, dazu gehört auch der Abstandswarner. Vor der Sicherheitsaufrüstung hatten wir eine deutlich kleinere Flotte, doch im Schnitt acht solcher schweren Unfälle jährlich.
Das Thema Sicherheit wollen wir weiter vorantreiben, nicht nur um andere Verkehrsteilnehmer zu schützen, sondern ebenso unsere eigenen Fahrer. Der letzte tödliche Unfall ist zum Glück schon lange her, das war 2008.
Was macht das mit Ihnen, wenn so etwas passiert?
Das ist schrecklich. Seit ich in der Firma bin, ist das zweimal vorgekommen. Das erste Mal 2005, da war ich ganz frisch dabei. Der Fahrer hatte die Motorbremse bei Glatteis von vier auf zwei gedrosselt, was einen großen Schub auslöste. Der Fahrer war nicht angeschnallt und wurde vom Fahrzeug erfasst. Das war eine bittere, tragische Geschichte.
Und wenn Sie dann auf der Beerdigung hinter dem Sarg und der Frau mit zwei kleinen Kindern hergehen, fühlen Sie sich schrecklich, obwohl Sie selbst gar nichts dafürkönnen. Allein der Gedanke schafft noch heute ein unwohles Gefühl in mir. Und die Namen dieser Mitarbeiter vergessen Sie auch nie.
Selbstverständlich unterstützen wir die Familie unserer Fahrer im Rahmen unserer Möglichkeiten seelisch, organisatorisch und auch finanziell, wenn ein Unfall mit tödlichem Ausgang passiert.
Welches ist die weiteste Strecke, die Ihre Fahrer zurücklegen müssen?
Aktuell ist das die Strecke von Stuttgart/Kornwestheim nach Sebes in Rumänien. Das ist eine einfache Strecke von 1.450 Kilometern, die wir für Daimler fahren.
Für das Werk Sebes sind wir das Cross-Dock. Das heißt, alle Gebietsspediteure liefern die Lieferantenteile für Rumänien bei uns an. Wir holen aus dem Werk Hedelfingen die Produktionsteile. Wir bündeln alles und übernehmen die Umverpackung von den Produktionskörben in Transportbehältnisse mit VCI-Folie, damit die Teile nicht rosten. Danach fahren wir alles nach Rumänien und der Fahrer bringt anschließend von dort fertige Getriebe mit zurück.
Haben Sie selbst Familie und auch Hobbys oder leben Sie vorwiegend für Ihr Unternehmen?
Ich bin mit einer tollen Frau verheiratet. Wir leben ein ganz normales Leben. Ich spiele Tennis, jogge, lese, treffe Freunde – alles ganz unspektakulär. Ich mache all die Sachen, die ich mache, gerne und mit großer Freude. Dazu gehört auch mein Job. Gar nichts zu tun, fällt mir dagegen unheimlich schwer – selbst im Urlaub.
Herr Große-Vehne, wir danken Ihnen für das Gespräch.