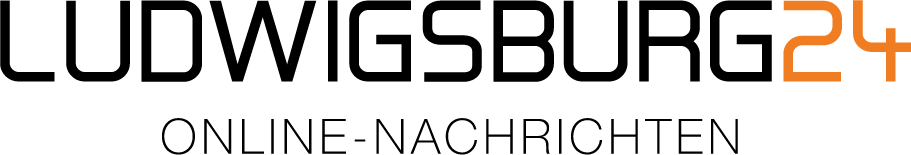Eine Gastkolumne von Gülseren Şengezer
Sie weisen Rassismus weit von sich. Sie verurteilen ihn und würden niemals das N-Wort in den Mund nehmen oder die Straßenseite bzw. ihren Sitzplatz im Bus wechseln, wenn ein Schwarzer Mensch sich Ihnen nährt. Das ist prima! Rassismus fängt aber nicht erst mit diesen Verhaltensformen an und endet bei einem Polizisten, der auf dem Hals eines Schwarzen sitzt, während er dabei gemütlich seine Hände in die Hosentasche steckt. Rassistische Diskriminierung fängt schon viel früher an. Hier ein kleiner Test: Wann haben Sie sich das letzte Mal bemüht einen nicht-deutschen Namen richtig auszusprechen?
Ich heiße Gülseren Şengezer. Alle „R´s“ in meinem Namen müssten gerollt werden. Das „S“ in meinem Vornamen ist stimmlos, das „S“ in meinem Nachnamen müsste mit einer Cedille, einem Häkchen geschrieben – also „Ş“ – und dann wie ein „Sch“ ausgesprochen werden. … Sind Sie hier schon raus? Ist das zu viel des Guten? Zu viel Differenzierung? Ich würde sagen, das ist eine weit verbreitete Haltung weißer [1] Menschen in Deutschland bei nicht-deutschen Namen keine Mühe zu zeigen, ihn richtig aussprechen zu wollen. Auch das ist rassistische Diskriminierung!
Ich habe die Verunglimpfung meines Namens schon so oft erlebt, dass ich irgendwann angefangen habe eine Liste darüber zu führen. Die phantasievollste Variante darunter war „Schöngießer“. Nun schreit der eine oder die andere gleich: Das Problem kennt eine Frau Leutheusser-Schnarrenberger oder eine Frau Kramp-Karrenbauer auch. Die Nachnamen der beiden Frauen enthalten objektiv betrachtet tatsächlich viele Buchstaben und stellen eine echte Herausforderung für den lingualen Muskelkörper aller Erdenbürger dar. Aber, diese Frauen sind weiße Frauen. Und werden ihre Namen falsch ausgesprochen, geht es um einen Versprecher, bei People of Color (PoC) [2] geht es um Ignoranz und Arroganz.
PoC erleben in diesem Kontext auch immer ein Moment, das ähnlich wie Sexismus manchmal schwer greifbar ist, nicht eindeutig. Es schwingt unterschwellig im Raum und macht den Umgang damit schwierig: es ist dieses diskriminierende Moment, in dem das Gegenüber zu seiner eigenen Bequemlichkeit meinen Namen falsch ausspricht oder ihn sogar eindeutscht. Das alles ist ein Ausdruck von Privilegien [3] weißer Menschen, die diese gegenüber Menschen anwenden, die sie als „anders“ markieren. Bewusst oder unterbewusst sind sie der Auffassung, dass weiß die Norm ist.
Welcher Hans oder welche Annegret wird beim ersten Kennenlernen gefragt, ob er Hansi oder Anni genannt werden dürfe? Ich wurde ständig gefragt, ob ich einen Spitznamen hätte. „Gülseren“ sei zu lang. Ungefragt kamen sogleich die skurrilsten Vorschläge.
Diese Form der Diskriminierung ist kurz und schmerzvoll – wie der Stich einer Mücke, der schnell wieder abklingt. Innerlich ist der Impuls vorhanden, etwas dagegen sagen zu müssen, aber der diffuse Charakter der Erniedrigung macht es schwer eine adäquate Reaktion zu zeigen. Außerdem wird man als Person of Color früh konditioniert in migrantischen Fragen nicht aus jeder Mücke einen Elefanten zu machen. Oft ist man es als PoC Leid mit solchen Menschen zu diskutieren. Ja, es macht müde, weil es Energie kostet. Wenn man sich doch darauf einlässt, gilt man als „anstrengend“ oder „hypersensibel“. Für PoC ist der Elefant im Raum deutlich zu sehen, auf dem groß „Diskriminierung“ steht.
Als ich während meiner Schulzeit im damals coolsten Mainzer Klamottenladen gejobbt habe, hat mein Chef mich eigenmächtig „umgetauft“! Gülseren war ihm zu kompliziert. Ich war für ihn nur noch die Ilse. Dessen nicht genug, hat er auch ständig das Lied von der Ilse Bilse, die keiner will, quer durch den Laden geträllert. Damals als Teenager fehlte mir der Mut, mich zu wehren und auch das Bewusstsein, dass mein Name Teil meiner Persönlichkeit ist und niemand das Recht hat, ihn zu verballhornen. Natürlich hatte ich auch Angst möglicherweise meinen Job zu verlieren.
Diese Herabsetzung zu decodieren hat lange gedauert. Rückblickend ist das Verhalten dieses privilegierten weißen Mannes nichts anderes als rassistische Diskriminierung und ein typisches Muster eines gesellschaftlichen Macht- und Herrschaftsverhältnisses von Weißen.
Wie ich schon eingangs geschrieben habe, geht es an dieser Stelle nicht um die Verhandlung des hässlichen weißen Rassismus, nicht um das offensichtlich Böse, sondern um die alltäglichen latenten Erniedrigungen. Die Verunglimpfung meines Namens mag harmlos erscheinen, in Relation zu schwerwiegenden Fällen von rassistischer Gewalterfahrung oder Diskriminierung bei der Job- bzw. Wohnungssuche, aber sie ist eine Variante davon.
Dennoch sind die Abwehrreflexe selbst darauf voraussehbar. Die Zweifler fühlen sich durch solche rassistischen Erfahrungsberichte stets angegriffen. Meine Schilderungen werden sicherlich als singuläre und subjektive Ereignisse abgetan. Noch schlimmer, sie zweifeln solche Erfahrungen oft an und versuchen reflexartig diese zu relativieren oder wollen keinen Zusammenhang zum „Anderssein“ erkennen. Die Soziologin Robin DiAngelo hat für diese ablehnende Reaktion den Begriff „white fragility” geprägt, was mit „weißer Zerbrechlichkeit“ übersetzt werden kann. Ein Blick in die Kommentarleisten zu Anti-Rassismus-Texten im Netz zeigt was DiAngelo damit meint.
Glaubhaft sind rassistische Erfahrungen für diese weißen Zweifler erst dann, wenn sie objektiv in Form von Zahlen oder Statistiken gemessen werden. Fakt ist: Bisher werden Studien zu Gleichstellungsdaten in Bezug auf Diskriminierung in Deutschland nicht erhoben. Deutschland sträubt sich bislang gegen die Erfassung seiner Bürger nach ethnischen Kriterien. Ein ganz aktuelles Beispiel für die institutionelle Abwehrhaltung einer Selbstreflexion offenbar die deutsche Bundesregierung. Sie möchte zurzeit den Rassismus in der Polizei wissenschaftlich nicht untersuchen lassen. Akademische Studien hinken der erlebten Wirklichkeit immer hinterher. Diskriminierung und Rassismus sind aber nicht nur wissenschaftliche Terminologien. Sie sind Praxis und alltägliches Handeln, denen PoC ausgesetzt sind.
Negieren führt also nicht weiter und löst kein Problem. Vielmehr müssten weiße Menschen anfangen ihre Perspektive zu wechseln und sich selbst auf den Prüfstand stellen und dabei den Blick auf ihr eigenes Weißsein richten. „Critical Whiteness“, die “kritische Weißseinsforschung” beschreibt Weißsein als übersehenes Privileg innerhalb des Rassimusdiskurses. „Critical Whiteness“ geht davon aus, dass People of Colour von Weißen als abweichend wahrgenommen werden. Weiß entspricht in diesem Konstrukt der Norm.
Wer Rassismus bekämpfen möchte, muss erkennen wie sehr er als Weißer der Nutznießer dieser Privilegien ist. Dieser Erkenntnisprozess könnte Unbehagen auslösen, denn es besteht die Gefahr, dass sie feststellen, dass es die Opfer von Rassismus nur gibt, weil es auch weiße Täter gibt.
Zurück zu meiner ursprünglichen Frage. Können Sie sie am Ende dieser Kolumne beantworten? Wann haben Sie sich das letzte Mal bemüht, einen nicht-deutschen Namen richtig auszusprechen? Ich selbst wurde sehr selten nach der richtigen Aussprache meines Namens gefragt. Das aber wäre ein guter Ausgangspunkt, um aus dem Elefanten eine Mücke zu machen.
[1] „Weiß“ hier kursiv geschrieben, bezieht sich nicht auf die Hautfarbe, sondern auf kulturelle und politische Konstruktionen, die im Kolonialismus als Norm etabliert wurden, mit dem Ziel, Privilegien der eigenen Gruppe und Rassismus zu legitimieren.
[2] People of Color (Singular: Person of Color) ist eine selbst gewählte Bezeichnung von Menschen, die sich als nicht-weiß definieren. PoCs verbindet ihre Rassismus- und Ausgrenzungserfahrungen seitens der Mehrheitsgesellschaft und die kollektive Zuschreibungen des „Andersseins“.
[3] Dieser soziologische Begriff beschreibt die Kultur weißer Gesellschaften, in denen ständig Signale ausgesendet werden, dass weißdie menschliche Norm sei, quasi ein menschliches Ideal. Nicht-weiß entspricht in dieser Konstruktion einer Abweichung von diesem Ideal. Das weiße Privileg als „normal“ wahrgenommen zu werden manifestiert sich im Alltag, z. B. bei der Job- oder Wohnungssuche, in Schulen bzw. auf der Arbeit oder im öffentlichen Raum. Hier werden privilegierte Weiße nicht mit stereotypen Zuschreibungen, verweigerten Zugängen oder diskriminierendem Verhalten konfrontiert. Privilegierte müssen sich mit Diskriminierung und der daraus folgenden Ungerechtigkeit erst gar auseinandersetzen.
ZUR PERSON:
Gülseren Şengezer ist eine deutsch-schwedische Filmemacherin und Journalistin mit kurdischen Wurzeln.
Geboren 1974 in Tunceli in der Türkei, zog sie mit ihrer Familie im Alter von 6 Jahren nach Deutschland. Ihr Studium der Pädagogik, Psychologie und Soziologie schloss sie im Jahre 2000 ab. Im selbigen Jahr bis 2013 arbeitete Gülseren Şengezer als Redakteurin beim Zweiten Deutschen Fernsehen (ZDF) in Mainz.
- 2010 erhielt sie für ihre Dokumentation „Die Brandkatastrophe von Ludwigshafen: Das Leben danach“ den Mainzer Journalistenpreis.
- 2013 wechselte Gülseren Şengezer erneut ihren Lebensmittelpunkt und zog in die schwedische Hauptstadt Stockholm.