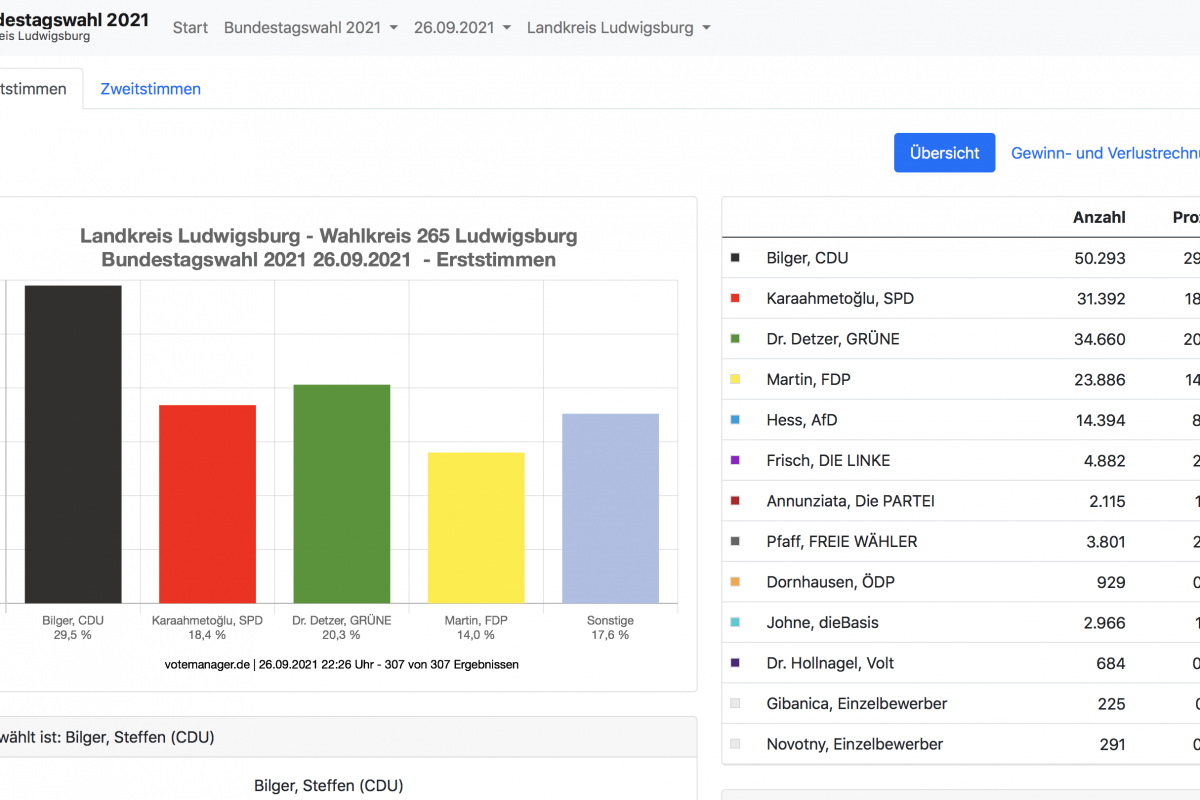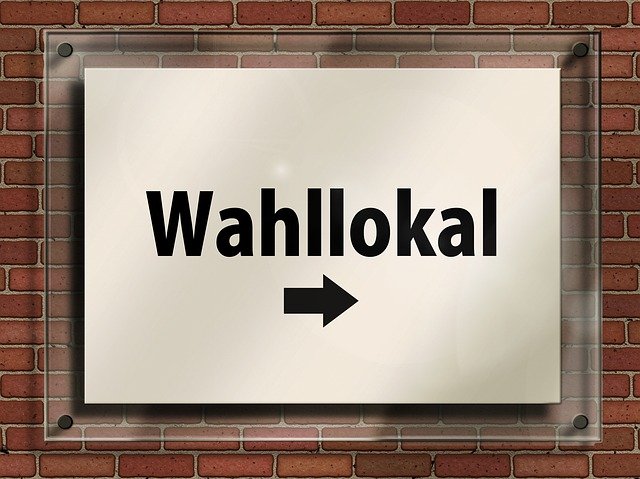Berlin – Bundeskanzler Olaf Scholz rechnet eigenen Angaben zufolge mit einer Mehrheit für die bestehende Ampel-Regierung bei der nächsten Bundestagswahl. “Ich bin ganz sicher, dass die SPD, wie bei der letzten Bundestagswahl, auch bei der nächsten gut abschneiden wird und ein Regierungsmandat bekommt, genauso, wie die gesamte Regierung”, sagte Scholz der Sendung “RTL Direkt Spezial”. Die Voraussetzung dafür sei, dass man “gute Arbeit” mache.
“Dass man, wenn es schwer wird, sich auf die Arbeit konzentriert und nicht gewissermaßen von einer Schlagzeile zur anderen läuft”, so der Kanzler. Das funktioniere nämlich nicht.
red