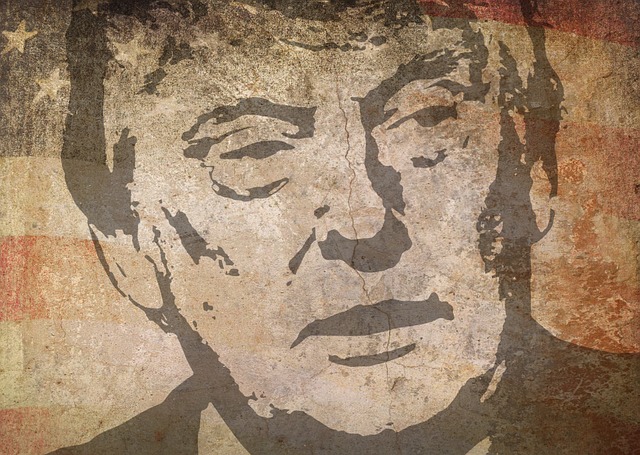Ein Beitrag von Nadja Schmidt – Kandidatin bei der Landtagswahl am 14. März 2021 für die Partei DIE LINKE in Ludwigsburg
Vor einigen Tagen habe ich mit einem guten Freund über das Thema Frauenpolitik gesprochen und über die Notwendigkeit einer Gleichstellungsbeauftragten im betrieblichen und politischen Kontext. Mein Freund, den ich für einen aufgeklärten und fortschrittlichen Menschen halte, hielt entgegen: Manchmal denke ich, wir bräuchten eher mehr Männerbeauftragte bei der Dominanz des Themas Frauenpolitik. Ich war baff erstaunt. Warum? Nicht, weil mir nicht klar wäre, dass es auch Männer gibt, die häusliche Gewalt erfahren oder Ungerechtigkeiten beim Thema Sorgerecht. Sondern weil mein Freund mit diesem Argument negiert, dass die Ungleichbehandlung von Frauen ein strukturelles Problem ist!
Sicher, das Thema Gleichberechtigung wirkt manchmal etwas verstaubt. Ich gebe zu, dass auch mir die Aktualität der Problematik erst richtig bewusst wurde als ich Mutter wurde. Ich bin Krankenschwester, der Vater meines Kindes arbeitet in der Autoindustrie. Ich verrate ihnen kein allzu privates Geheimnis wenn ich ihnen sage, dass er deutlich mehr verdient als ich. Entsprechend kurz viel die Diskussion aus, als es nach der Geburt unseres Kindes darum ging, wer ein Jahr lang Zuhause bleibt. Dreimal dürfen Sie raten … Verstehen sie mich nicht falsch, ich bin gerne bei meinem Kind geblieben, aber ich bin nicht der häusliche Typ und ich hätte gerne die Option gehabt, nach einigen Monaten zu wechseln. Aber wirtschaftlich wäre es einfach unvernünftig gewesen. Was auch der Grund ist warum ich diejenige war, die nach diesem Jahr Elternzeit in Teilzeit ging, damit unser Kind nicht mit einem Jahr in Vollzeitbetreuung musste. Vor meiner Abwesenheit war ich stellvertretende Vorsitzende in unserem Betriebsrat. Danach nicht mehr. Und jetzt stellen Sie sich vor, was es mit ihren beruflichen Chancen macht, wenn sie das zwei oder dreimal machen.
Jetzt können Sie natürlich sagen, dass meine Geschichte ein Einzelfall, ein individuelles Problem ist. Aber so ist es nicht. Über 85% der Pflegekräfte in der Altenpflege sind laut dem Bundesministerium für Gesundheit weiblich. Ähnlich groß und noch höher ist der Frauenanteil der Pflegekräfte in den Kliniken, der Erzieherinnen und der Heilerziehungspflegerinnen. Womit wir einige der am schlechtesten bezahlten Ausbildungsberufe in unserer Gesellschaft genannt hätten. Verdient die Frau in einer Beziehung aber weniger, wird sie viel eher in die klassische Rollenverteilung gedrängt. Durch Teilzeit und fehlendem Aufstieg verschärft sich dieses Bild noch. Diese Umstände führen zu einem Gender-Pay-Gap in Deutschland von rund 19% im Jahr 2020. Das heißt, dass Frauen fast 20 % weniger verdienen als Männer! Stellen Sie sich vor, was es für eine Frau mit geringem Einkommen bedeutet, sich von ihrem Mann zu trennen und in einer Stadt wie Ludwigsburg eine Wohnung zu finden. Manche Frau wird sich angesichts ihrer finanziellen Situation dagegen entscheiden. Vielleicht sogar, obwohl sie von ihm Gewalt erfahren muss. (Übrigens denke ich nicht, dass die Männer an der Benachteiligung der Frauen schuld sind. Wir haben hier ein gesellschaftliches Thema, das gemeinsam von uns allen, unabhängig unserer Geschlechtes angegangen werden muss)
Die wirtschaftliche Unabhängigkeit der Frau ist der wichtigste Schlüssel zur Emanzipation. Und hier liegt noch sehr viel im Argen. Viele klassische „Frauenberufe“ sind unterbezahlt und Sorgearbeit wird nicht honoriert. Mädchen und junge Frauen müssen noch mehr motiviert und gefördert werden, in berufliche Männerdomänen vorzudringen und wir müssen Frauen gezielt in Führungspositionen bringen. Aus meiner Sicht auch gerne mit einer Quote. Darüber hinaus gilt es, Geschlechterstereotypen zu hinterfragen und warum die katholische Kirche ihr vorsinnflutartiges Frauenbild leben und gleichzeitig unsere Kinder erziehen darf.
Und falls das noch nicht reicht um Sie davon zu überzeugen, dass wir noch nicht fertig sind mit dem Thema Emanzipation: Vier von fünf Gewaltopfern in Beziehungen sind weiblich. Jeden dritten Tag wird eine Frau in Deutschland von Ihrem Partner oder Expartner getötet. Täglich werden Frauen und Mädchen Opfer schwerster sexualisierter Gewalt. Nur 36,5 % der Aufsichtsräte deutscher DAX-Unternehmen sind weiblich. 14 von 40 Stadträten in Ludwigsburg sind Frauen. Im Baden-Württembergischen Landtag liegt ihr Anteil bei 26,6%. Bäm!
Ich möchte bitte nie wieder den Ruf nach einem Männerbeauftragten hören!
Fast am Ende meines Textes möchte ich über Eines noch aufklären: Wir sprechen heute von einer Gleichstellungsbeauftragten und nicht einer Frauenbeauftragten, weil diese Person Geschlechterdiskrimminerung aller Art angehen soll. Und ganz zum Ende noch eine Zahl, die Hoffnung macht: Vier von fünf der Ludwigsburger Kandidat*innen für die Landtagswahl sind Frauen. Junge Frauen brauchen weibliche Vorbilder. Liefern wir sie ihnen in Kolleginnen!