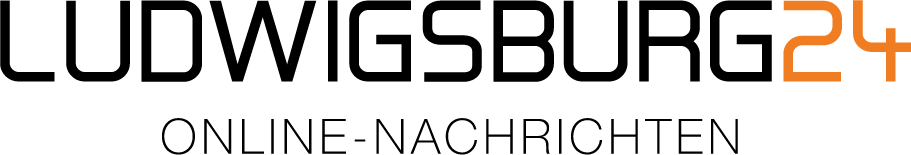Am 28. Mai erzielte Amtsinhaber Erdogan einen knappen Sieg in der Stichwahl um das höchste Amt der Türkei und wird somit weiterhin als Staatspräsident fungieren. Die politischen Ereignisse im Vorfeld und im Nachgang dieser emotional geführten Wahl entfachten leidenschaftliche Diskussionen und hitzige Debatten, sowohl in der Türkei als auch hierzulande in Deutschland. Inmitten dieses aufgeladenen politischen Klimas äußerte sich der SPD-Bundestagsabgeordnete Macit Karaahmetoglu aus Ludwigsburg in einem exklusiven Interview mit Ludwigsburg24 zu den brisanten Themen. Das Gespräch beleuchtet eine Vielzahl facettenreicher Aspekte und bietet einen eindrucksvollen Einblick in das Wahlverhalten türkischer Staatsbürger in Deutschland sowie die Beweggründe deutscher Politiker, die sich entschieden gegen Erdogan positionierten. Zudem äußerte Karaahmetoglu eine kritische Haltung gegenüber Agrarminister Cem Özdemir aufgrund seines umstrittenen Vergleichs, der eine breite Debatte auslöste und zu kontroversen Reaktionen führte.
Ein Interview von Ayhan Güneş
LB24: Im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen, sowohl im ersten Wahlgang als auch in der Stichwahl, haben sich zahlreiche deutsche Politikerinnen, Politiker und Mandatsträger öffentlich geäußert. Die Vorsitzenden der Grünen haben eine eindeutige Haltung gegenüber Präsident Erdogan eingenommen und klar dazu aufgerufen, nicht für ihn zu stimmen. Auch Sie haben sich gegen Erdogan ausgesprochen. Was ist die Motivation solcher Äußerungen?
MK: Es ist ein Unterschied, ob man als einzelner Abgeordneter wie ich sagt, dass man sich einen Erfolg der Opposition wünschen würde oder ob Parteivorsitzende sowie Bundesminister eine explizite Wahlempfehlung abgeben. Zweites halte ich für bedenklich. Es war unterm Strich eine Unterstützung von Erdogan, der sich in seiner Erzählung, westliche Mächte würden sich ständig einmischen, bestätigt sehen konnte. Ich glaube, dass die Grünen eigentlich mit einem außenpolitischen Thema Innenpolitik betrieben haben. Sprich: Sie wollten bei deutschen Wählerinnen und Wählern punkten mit einem populistischen Wahlaufruf.
LB24: Warum wurde im Vorfeld von Wahlen wie beispielsweise in Russland 2018 oder China keine solchen Aussagen und Empfehlungen abgegeben? Was waren die Gründe für diese Zurückhaltung?
MK: Das hat vor allem damit zu tun, dass die Türkei für uns ein besonders wichtiges Land ist. Es hat strategisch gesehen eine große Bedeutung, da es sich in einer Region befindet, in der es viele Konflikte und Krisen gibt. Die Türkei liegt zwischen Europa, Asien und Afrika. Zudem ist sie nach wie vor EU-Beitrittskandidat und NATO-Mitglied, wir haben starke wirtschaftliche Beziehungen und eine bedeutende türkischstämmige Bevölkerung in Deutschland. Die Geschichte zwischen Deutschland und der Türkei ist tiefgreifend und hat starke Traditionen. Aus diesen Gründen ist die Türkei für uns ein wichtiges Land.
LB24: Russland und China sind ebenfalls bedeutende Länder für Europa und Deutschland, und auch hier leben eine beträchtliche Anzahl an Russlanddeutschen.
MK: China kann man nicht mit Russland oder der Türkei vergleichen, da es geografisch weit entfernt ist und es hier vergleichsweise wenige Chinesen gibt. Die Verbindung zu China ist eine andere. Was Russland betrifft, gibt es hier in Deutschland zwar viele Menschen russlandstämmiger Herkunft, das Land ist aber weder mit der EU noch der NATO verbunden. Entscheidender Unterschied ist zudem, dass die Türkei eine starke Zivilgesellschaft hat und Machtwechsel grundsätzlich durch Wahlen möglich sind. Das hat man bei den Kommunalwahlen 2018 gesehen.
LB24: Viele türkischstämmige Wähler in Deutschland fühlten sich von Politikerinnen und Politikern bevormundet, da diese klare Wahlempfehlungen gegen Erdogan und für die Opposition aussprachen. Es entstand der Eindruck, dass sich die Politik nicht um ihre Belange und Bedürfnisse kümmert, es sei denn, es geht um Erdogan. Hat sich diese Strategie letztendlich als kontraproduktiv erwiesen?
MK: Man muss berücksichtigen, dass wir uns in einem freien Land befinden, in dem man sich auch frei äußern darf. Dass dies auch zu einem Land wie der Türkei passiert, zu dem wir starke Verbindungen haben, ist daher völlig klar. Millionen von Menschen machen Urlaub in der Türkei, es gibt deutsch-türkische Familien und rund 3 Millionen Menschen mit türkischen Wurzeln leben hier. Daher ist es natürlich, dass sich die Menschen für die Türkei interessieren und ihre Meinung äußern möchten. Ich selbst wurde in der Türkei geboren und habe starke Verbindungen zu diesem Land. Folgerichtig interessiere ich mich für das politische Schicksal der Türkei und äußere auch meinen Wunsch, dass das Land auf den Pfad der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zurückkehrt.
Auf der anderen Seite halte ich es für falsch, wenn nicht nur Einzelpersonen und Abgeordnete sondern Institutionen und sogar Parteien solche Vorschläge machen oder Wahlempfehlungen abgeben. Die türkischstämmigen Menschen haben dann natürlich einen Punkt, wenn sie sagen, dass ihre Anliegen nur selten Beachtung finden, man sich dann aber für sie interessiert, wenn sie Erdogan wählen.
LB24: Würden Sie diese Wahl als Schicksalswahl bezeichnen?
MK: Ich persönlich halte es nicht für angemessen, jede Wahl in der Türkei als Schicksalswahl zu bezeichnen. Die Grundbedingungen der Wahl waren nicht fair dadurch dass Erdogan 90% der Medien kontrolliert. Er führte einen schmutzigen Wahlkampf, in dem er die Opposition mit Lügen überzog. Er präsentierte sogar ein gefälschtes Video vor Zehntausenden von Zuschauern und verbreitete es über die kontrollierten Medien weiter. Alles stand unter dem Ziel, den Oppositionsführer in die Nähe der Terrororganisation PKK zu rücken.
Trotz dieser massiven Propaganda gelang es Erdogan am Ende nur, 52 Prozent der Stimmen zu erhalten. Das zeigt, dass wir in der Türkei eine starke Zivilgesellschaft und eine starke Opposition haben. Mit dieser Wahl ist vielleicht der Weg für die nächsten Jahre aber gewiss nicht das Schicksal des Landes besiegelt worden.
LB24: In Deutschland haben rund 730.000 Wähler (entspricht 67 %) für Erdogan gestimmt, was im Vergleich zur Türkei und anderen Ländern außerhalb der Türkei eine sehr deutliche Mehrheit darstellt. Wie erklären Sie sich das?
MK: Es gibt drei Gründe dafür. Der erste Grund ist, dass viele Türken, die in Deutschland leben, aus den Erdogan-Hochburgen Schwarzes Meer und Inneranatolien stammen, wo die Mehrheit bereits konservativ geprägt ist und daher eine natürliche Nähe zur Partei AKP und Erdogan empfindet.
Der zweite Grund ist – wir haben es eben schon angerissen – dass viele Menschen mit türkisch-muslimischem Hintergrund in Deutschland das Gefühl haben, benachteiligt zu sein. Sie empfinden zudem, dass die Türkei nicht die Wertschätzung erhält, die sie verdient, und dass sie selbst als Bürger dieses Landes abschätzig behandelt werden. Sie haben das Gefühl, als Menschen zweiter Klasse betrachtet zu werden. Viele von ihnen fühlen sich diskriminiert bei der Wohnungssuche und der Jobsuche. Das Thema der doppelten Staatsbürgerschaft betrifft sie ebenfalls, da sie oft davon ausgeschlossen sind. Das kommunale Wahlrecht ist ein weiteres Thema, bei dem sie benachteiligt werden. All diese Formen der Benachteiligung führen dazu, dass Erdogan für viele dann die Antwort ist. Er gibt ihnen das Gefühl, etwas wert zu sein. Er hat die Türkei zu einer regionalen Macht geformt und gilt als starker Mann, der all diesen Ungerechtigkeiten und den Staaten des Westens etwas entgegenzusetzen hat.
Der dritte Grund ist, dass die Türken in Deutschland sich fast ausschließlich aus Medienquellen informieren, die von Erdogan kontrolliert werden. Das betrifft fast 90 Prozent der Medien, die von den Deutsch-Türken nahezu ausschließlich konsumiert werden. Dadurch entsteht natürlich ein Bild von Erdogan, das nicht der Realität entspricht.
LB24: Nachdem bekannt gegeben wurde, dass Erdogan die Stichwahl gewonnen hatte, kam es spontan zu Jubelfeiern und Autokorsos in vielen deutschen Städten, einschließlich Stuttgart und der Region. Es entstand der Eindruck, als hätte die Türkei die Fußballweltmeisterschaft gewonnen, obwohl es eigentlich nur eine innenpolitische Wahl war.
Wie ist das zu erklären?
MK: Das zeigt die emotionale Seite der gesamten Situation. Man kann sagen, dass es zwei Mannschaften gibt: das türkische Team und das türkeikritische Team. Die Menschen haben den Eindruck, dass das pro-türkische Team gewonnen hat, und das ist der Grund für die Feiern. Es ist wichtig zu betonen, dass dies nur ihre persönliche Empfindung ist und nicht die objektive Realität widerspiegelt. Aus ihrer Perspektive haben diejenigen verloren, die die Türkei nicht lieben und den Türken etwas Schlechtes wünschen.
LB24: So gesehen war es mehr als nur eine politische Wahl.
MK: Es ist klar, dass es für die Türken eine emotionale Angelegenheit war. Für viele war die Wahl Erdogans gleichzeitig eine Gelegenheit, der Mehrheitsgesellschaft, die die Türken und die Türkei so wenig wertschätzt, einen Denkzettel zu verpassen. Es ging ihnen um mehr als nur politische Entscheidungen.
LB24: Viele Menschen haben auch für die Opposition gestimmt. Wie gedenken Sie und Ihre Partei nach der Wahl mit diesen enttäuschten Menschen umzugehen?
MK: Es ist wichtig, immer wieder deutlich zu machen, dass eben knapp die Hälfte der Wählenden für die Opposition gestimmt hat. Die pro-demokratische türkische Zivilgesellschaft muss sichtbar bleiben und gehört werden. Das umfasst auch diejenigen, die in Deutschland leben und sich für eine Rückkehr zur Demokratie, die Stärkung von Minderheitenrechten oder den wirtschaftlichen Aufschwung in der Türkei stark machen. Die SPD ist Schwesterpartei der CHP und wird weiter solidarisch an ihrer Seite stehen in der Hoffnung, dass sie eines Tages ein noch besseres Ergebnis zum Wohl der Türkei einfahren kann.
LB24: War es im Großen und Ganzen trotzdem eine demokratische Wahl?
MK: In der Wissenschaft kursiert für die heutige Türkei der Begriff der elektoralen Autokratie. Erdogan ist Autokrat, es finden aber freie Wahlen im Sinne einer weitestgehend freien Stimmabgabe statt. Die Bedingungen vor der Wahl waren aber keineswegs fair. Die einseitige Kontrolle der Medien und die ungleiche Präsenz der Kandidaten haben zu einer Verzerrung des Wahlkampfes geführt. Dies beeinträchtigt die demokratische Legitimation der Wahl. Es ist wichtig, diese Ungleichheiten anzusprechen und sicherzustellen, dass zukünftige Wahlen in der Türkei demokratisch und fair sind, indem gleiche Chancen für alle Kandidaten und Parteien gewährleistet werden.
LB24: Landwirtschaftsminister Cem Özdemir hatte Bundeskanzler Scholz aufgefordert, in Bezug auf die Türkei eine Zeitenwende einzuläuten, indem er die Wahl Erdogans mit dem Angriffskrieg Russlands verglichen hatte. Wie beurteilen Sie diese Aussage?
MK: Ich finde es völlig unangemessen, die Wahl in der Türkei mit dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands auch nur irgendwie zu vergleichen. Und das tut der Begriff „Zeitenwende“ unweigerlich. Die Situation in der Ukraine ist eine humanitäre Tragödie mit schwerwiegenden Konsequenzen für Millionen von Menschen. Solche Vergleiche sollten mit Vorsicht und Sensibilität gemacht werden, um die Ernsthaftigkeit der Ereignisse angemessen zu würdigen. Es ist wichtig, dass politische Aussagen verantwortungsvoll und fundiert sind, um den tatsächlichen Situationen gerecht zu werden.
Herr Karaahmetoglu, wir danken Ihnen für das Gespräch.