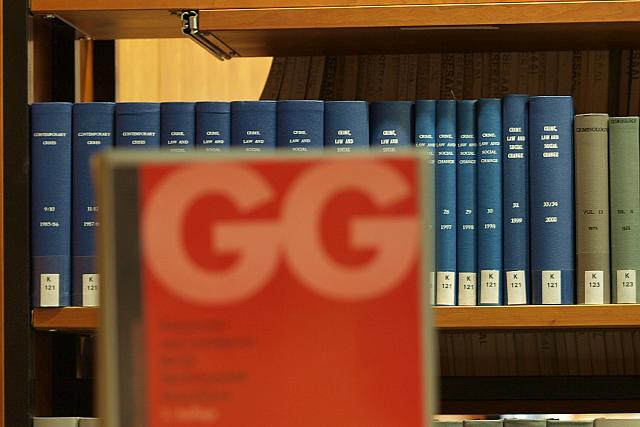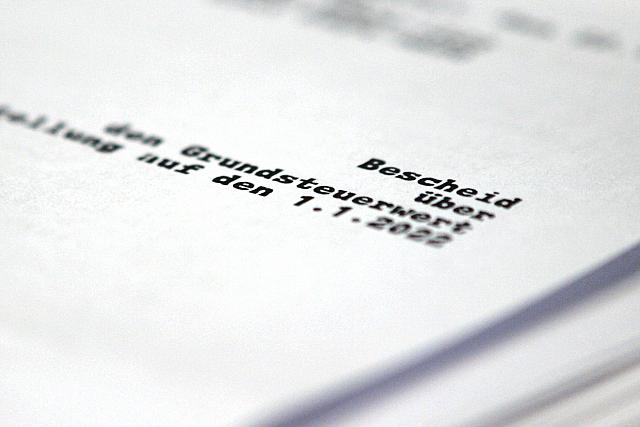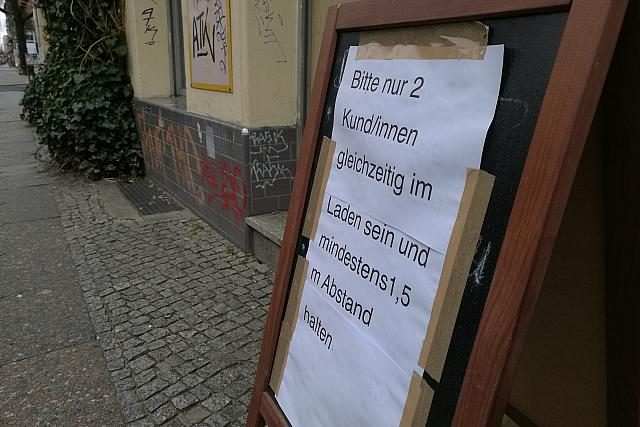Bei den Krawallen im Leipziger Stadtteil Connewitz sind in der Nacht zu Samstag 23 Polizisten leicht verletzt worden. 17 beschädigte Einsatzfahrzeuge seien zu verzeichnen, teilte die Polizei am Samstagmittag in einer ersten Zwischenbilanz mit. Auch mehrere Fahrzeuge von Unbeteiligten wurden teils in Brand gesetzt und beschädigt, außerdem entstand an einer Sparkassenfiliale in der Zweinaundorfer Straße ein Schaden in hoher fünfstelliger Summe.
Im Zuge des Polizeieinsatzes konnten mehrere Tatverdächtige gestellt und fünf vorläufige Festnahmen ausgesprochen werden, zudem kam es zu drei “Ingewahrsamnahmen”, wie die Polizei mitteilte. Es wurden mehrere Strafverfahren unter anderem wegen schweren Landfriedensbruchs eingeleitet. Mindestens ein Medienvertreter wurde durch einen Unbekannten angegriffen und leicht verletzt.
Die Polizei will am Samstag an mehreren Zufahrtswegen zu Leipzig Kontrollen durchführen, auch ein Polizeihubschrauber kreist über der Stadt. Linksautonome haben den Samstag zum “Tag X” erklärt und zu Protesten und Solidaritätsbekundungen aufgerufen – obwohl eine angemeldete Demo offiziell verboten wurde. Dabei geht es um die in der letzten Woche verurteilte Gruppe um die Linksextremistin Lina E., die Rechtsradikale brutal überfallen haben und dabei auch den Tod ihrer Opfer in Kauf genommen haben soll.
Lina E. wurde allerdings trotz mehrjähriger Haftstrafe sofort nach dem Urteil auf freien Fuß gesetzt, weil sie bereits über zwei Jahre in U-Haft saß.
red