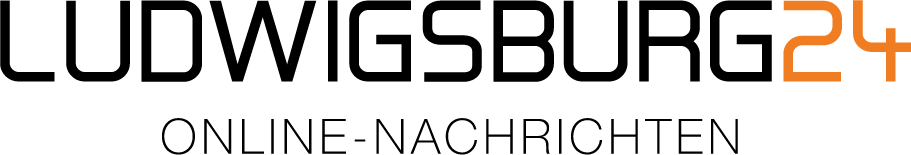Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) will mit einer Verschärfung des Tierschutzgesetzes den Schutz von Nutz- und Haustieren verbessern. “Der Koalitionsvertrag benennt konkrete Vorhaben, um den Tierschutz zu verbessern”, sagte eine Sprecherin des Ministeriums dem “Tagesspiegel” (Montagsausgabe). “Wir greifen diese Punkte auf und setzen sie um”.
Nach den Plänen Özdemirs sollen Tiere nicht mehr ganzjährig angebunden sein dürfen, nicht-kurative Eingriffe wie das Enthornen von Rindern oder das Abschneiden des Ringelschwanzes von Ferkeln sollen reduziert und nur noch unter Betäubung durchgeführt werden. Für Tiere, die aus Qualzuchten hervorgehen, plant Özdemir ein Ausstellungs- und Werbeverbot. Im Referentenentwurf des Ministeriums, der sich derzeit in der Ressortabstimmung befindet, fehlt allerdings bislang eine Definition, was darunter fällt.
Um illegalen Welpenhändlern das Handwerk zu legen, sollen Internet-Plattformen künftig die Identität der Verkäufer feststellen müssen. Das Ministerium strebt zudem in einer späteren Verordnung eine Registrierungspflicht für alle Hunde und Katzen an. Die Strafen für Tierquäler sollen deutlich verschärft werden – auf bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe und Geldbußen bis zu 100.000 Euro.
Nach der verpflichtenden Haltungskennzeichnung für Schweine ist das Tierschutzgesetz die nächste Reform Özdemirs für mehr Tierwohl. “Mit der Tierhaltungskennzeichnung wollen wir die Haltung der Tiere verbessern, die Reform des Tierschutzgesetzes gehört dazu”, sagte die agrarpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Susanne Mittag, dem “Tagesspiegel”. Für Tierschützer ist der Entwurf ein Anfang: Der Entwurf mache deutlich, dass das Ministerium die gesellschaftliche Relevanz und den Verfassungsrang von Tierschutz anerkennt, sagte Rüdiger Jürgensen, Mitglied der Geschäftsleitung von “Vier Pfoten” Deutschland.
Das zeige sich etwa in den höheren Strafen. In vielen Punkten fordert Jürgensen aber Nachbesserungen. “Das Abschneiden des Ringelschwanzes und das Kupieren des Schnabels bleiben weiterhin möglich”, kritisiert er.
red