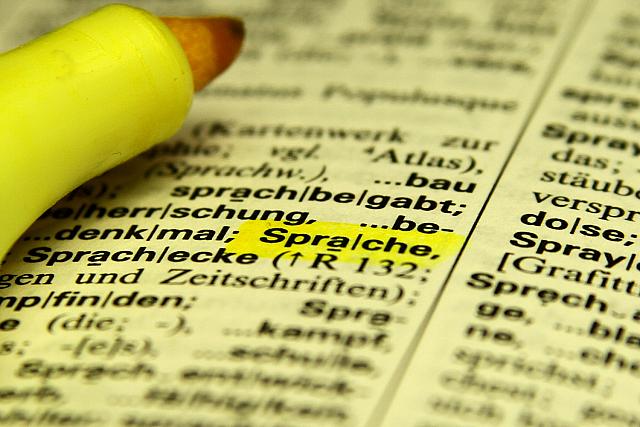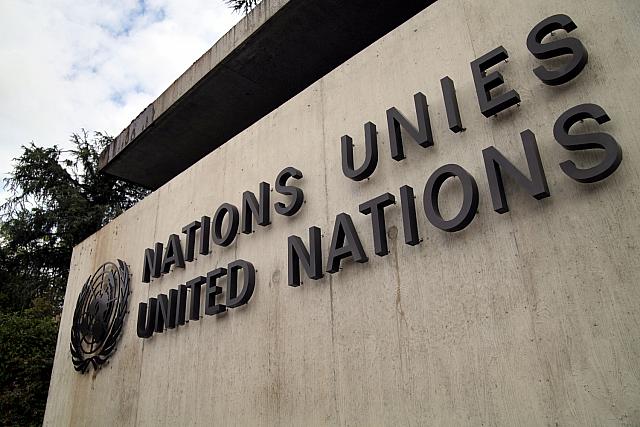Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) rechnet nach der Sommerpause mit einer Verabschiedung des geplanten Selbstbestimmungsgesetzes durch das Bundeskabinett. “Mein Ziel ist klar: Zügig nach der Sommerpause wollen wir den Entwurf für das Selbstbestimmungsgesetz im Kabinett beschließen”, sagte Buschmann der “Rheinischen Post” (Freitagausgabe). “Der Bundestag soll endlich über das Gesetz beraten können”, so der FDP-Politiker.
“Ich rechne damit, dass die Debatte um das Selbstbestimmungsgesetz im Bundestag lebhaft wird.” Ihm gehe es um eine behutsame und pragmatische Fortentwicklung des Rechts. “Wir haben größten Wert daraufgelegt, alle Möglichkeiten des Missbrauchs – und seien sie noch so fernliegend – auszuschließen.”
Die überfällige Besserstellung von Personen, deren Geschlechtsidentität vom Geschlechtseintrag abweiche, werde auch nicht zu Lasten anderer gehen, sagte der Minister. “Und es wird sich viel weniger ändern, als viele meinen. Vertragsfreiheit und Hausrecht bleiben gewahrt – so wie es in einer liberalen Gesellschaftsordnung selbstverständlich ist”, sagte Buschmann.
Nach den Plänen der Koalition soll jeder Mensch in Deutschland künftig seinen Geschlechtseintrag und seinen Vornamen selbst festlegen und in einem einfachen Verfahren beim Standesamt ändern können. Das Gesetz richtet sich an transgeschlechtliche, intergeschlechtliche und nicht-binäre Menschen. Kritik
red