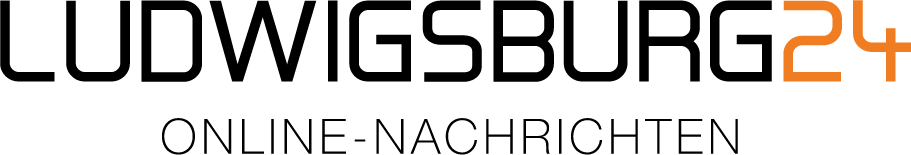Die frühere Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht erwartet einen Niedergang ihrer alten Partei. Für die aktuelle Politik der Parteiführung, für die auch die Europa-Spitzenkandidatin Carola Rackete stehe – “offene Grenzen und Bleiberecht für jeden und radikaler Klimaaktivismus” – gebe es “kein ausreichendes Wählerpotenzial”, sagte sie wenige Tage vor dem Linken-Bundesparteitag dem “Redaktionsnetzwerk Deutschland”. Die Linke sei aber nicht ihr politischer Gegner: “Ich wünsche der Partei, dass sie sich findet.”
Wagenknecht hatte zuletzt angekündigt, eine neue Partei zu gründen. Dabei wird sie von mehreren bisherigen Linken-Bundestagsabgeordneten unterstützt. Die Linksfraktion will in dieser Woche den Zeitplan für ihre Auflösung beschließen.
Sie bekomme auch Zuschriften von Menschen, “die enttäuscht sind, dass ich die Linke verlassen habe”, sagte Wagenknecht. “Sie hoffen immer noch, dass es möglich sein wird, die Linke wieder auf einen vernünftigen Kurs zu bringen. Das ist nachvollziehbar, aber ich habe diese Hoffnung leider nicht mehr.”
Gegenüber dem RND äußerte sich die Politikerin auch zur AfD – und lehnte ein Verbot kategorisch ab: “Ich halte die Forderung nach einem AfD-Verbot für völlig falsch und schon die Diskussion darüber finde ich gefährlich”, sagte Wagenknecht. “Unliebsame Parteien mal eben zu verbieten, weil sie zu stark werden, ist mit einer freien Gesellschaft unvereinbar. Einen politischen Konkurrenten mit verfassungswidrigen Verbotsanträgen zu bekämpfen, ist mit einem demokratischen Anspruch unvereinbar.”
Mit ihrer neuen Partei “Bündnis Sahra Wagenknecht” will Wagenknecht explizit auch AfD-Wähler ansprechen: “Ich freue mich, wenn Wähler der AfD in Zukunft uns wählen, weil sie unser Angebot seriöser und überzeugender finden”, sagte sie. “Weil sie bemerken, dass die wirtschafts- und sozialpolitischen Vorstellungen der AfD unser Land noch ungerechter machen würden.”
red