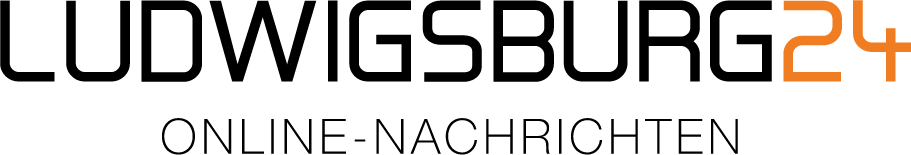Seit 2022 wird das Beschäftigungswachstum in der Pflege ausschließlich von ausländischen Beschäftigten getragen, die Zahl deutscher Pflegekräfte ist hingegen rückläufig. Das zeigt eine am Dienstag veröffentlichte Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB).
Die Gesamtbeschäftigung in den Pflegeberufen ist demnach im Zeitraum von 2013 bis 2023 um 26 Prozent gestiegen. Knapp 1,7 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte waren im Juni 2023 in der Pflege tätig.
Jede sechste Pflegekraft kam aus dem Ausland, so die Studie. Ausländische Pflegekräfte federn den demografisch bedingten Rückgang der deutschen Beschäftigten damit maßgeblich ab. Zugleich tragen sie dazu bei, dass der Arbeitskräftemangel in der Pflege nicht noch größer ausfällt und der Pflegebetrieb so aufrechterhalten wird.
“Unter den Pflegekräften mit deutscher Staatsangehörigkeit befinden sich mittlerweile deutlich mehr ältere als jüngere Beschäftige. Viele von ihnen erreichen in den nächsten Jahren das Rentenalter”, erläuterte IAB-Forscher Holger Seibert.
Ausländische Beschäftigte erzielten in Pflegeberufen zwischen 2013 und 2023 ein stark überproportionales Beschäftigungswachstum: In der Altenpflege um 273 Prozent, das entspricht einer Zunahme von fast 87.000 ausländischen Personen. Auch in der Krankenpflege war eine Zunahme von 109.000 ausländischen Beschäftigten zu beobachten – damit steigerte sich ihr Beschäftigungsstand um 256 Prozent, wie aus den Daten des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hervorgeht. In der Krankenpflege erhöhte sich demnach der Anteil ausländischer an allen Pflegekräften innerhalb von zehn Jahren von 4,9 auf 14,5 Prozent. In den Altenpflegeberufen lag der Anteil 2023 mit 18,9 Prozent 12 Prozentpunkte höher als noch 2013.
2023 waren mehr ausländische Pflegekräfte aus Nicht-EU-Ländern als aus der EU in Deutschland tätig, so die Studie. Innerhalb der EU kommen Pflegekräfte vor allem aus Polen, Kroatien und Rumänien. Staatsangehörige aus der Türkei und Serbien bilden hingegen eine große Gruppe unter den Pflegekräften aus Drittstaaten. Aus Ländern mit Anwerbevereinbarungen kommen besonders viele Pflegekräfte aus Bosnien-Herzegowina, den Philippinen, Indien, Tunesien und Vietnam.
Viele Länder Europas haben mit Blick auf die demografische Entwicklung einen ähnlich hohen Pflegekräftebedarf wie Deutschland. Die deutschen Pflegeeinrichtungen stehen bereits heute und werden daher auch in Zukunft in einer verstärkten internationalen Konkurrenz um ausländische Pflegekräfte stehen, schlussfolgert die Studie.
“Neben erleichterten Zuwanderungsregeln für Arbeitskräfte, wird es auch um eine zügigere berufliche Anerkennung und höhere Wertschätzung der mitgebrachten Qualifikationen und Kompetenzen der Pflegekräfte aus dem Ausland gehen”, so IAB-Forscherin Doris Wiethölter. “Generell brauchen wir eine verbesserte Willkommenskultur, um neue Beschäftigte auch langfristig in Deutschland halten zu können.”
red