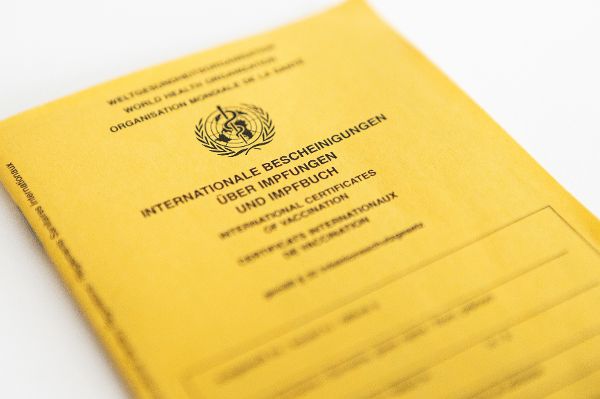Wenn die sommerliche Hitze über lange Zeit anhält und auch nicht mal die Nächte Abkühlung bringen, kann das für den Körper schnell zur Belastung werden. Was also tun, wenn die Temperaturen auch dieses Jahr wieder weit in die Höhe steigen? Hier ein paar einfache Tipps, wie die Hitze im Sommer erträglicher wird.
Laut CosmosDirekt verliert der Körper durch das vermehrte Schwitzen im Sommer viel Flüssigkeit und wichtige Salze. Um einer Dehydrierung vorzubeugen, die zu Kopfschmerzen und Kreislaufproblemen führen kann, empfiehlt es sich, ein bis zwei Liter mehr als die gewohnte Trinkmenge zu sich zu nehmen, am besten Mineralwasser oder verdünnte Säfte.
Gesüßte Getränke, Kaffee und zu kalte Getränke sind hingegen lieber zu vermeiden, weil die das Durstgefühl oft noch steigern oder dem Körper zusätzliche Energie abfordern. Wem es schwer fällt, im Sommer ausreichend zu trinken, kann sich per App daran erinnern lassen oder das Wasser mit Zitrone und Minze geschmacklich verfeinern.
Wasserhaltige Nahrungsmittel wie Gurken oder Wassermelonen unterstützen den Flüssigkeitshaushalt. Auf schwer verdauliche und fettige Speisen sollte man im Sommer verzichten, da der Körper beim Verzehr viel Energie braucht, die wiederum Wärme produziert. Besser geeignet sind frische Salate und vitaminreiche Rohkost in mehreren kleinen Mahlzeiten über den Tag verteilt. Als leichtes Abendessen schmeckt bei hohen Temperaturen etwa eine kalte Gemüsesuppe besonders gut.
“Um die eigene Wohnung möglichst kühl zu halten, wird am besten in den frühen Morgenstunden gelüftet und anschließend sollten alle Fenster geschlossen und abgedunkelt werden, damit keine warme Luft mehr in die Wohnung gelangt”, so die Experten. Und wenn es doch mal zu heiß wird, lässt sich beispielsweise eine Wärmflasche ganz einfach umfunktionieren: Mit kaltem Wasser gefüllt und für kurze Zeit in den Kühlschrank gelegt, bringt sie eine angenehme Kühle. Für einen Frische-Kick zwischendurch sorgt auch kaltes Wasser an den Handgelenken oder im Nacken.
Rudolf Huber