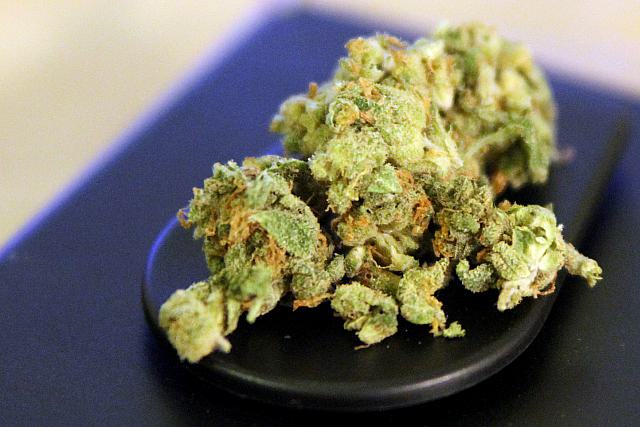Die finanzielle Schieflage der gesetzlichen Krankenkassen (GKV) hat sich im vergangenen Jahr wieder zugespitzt. Dies geht aus vorläufigen Daten der größten Krankenkassenverbände hervor, über die das “Handelsblatt” (Donnerstagausgabe) berichtet.
Demnach dürfte das Defizit im vergangenen Jahr rund 1,9 Milliarden Euro betragen haben. 2022 schloss die GKV noch mit einem Plus von rund 451 Millionen Euro. Die Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK) meldeten für das abgelaufene Jahr ein Minus von 225 Millionen Euro. Das Defizit der Betriebskrankenkassen wiederum betrug 360 Millionen Euro, jenes der Knappschaft 124 Millionen Euro und das der Innungskrankenkassen 24 Millionen Euro.
Besonders drastisch aber fällt der Fehlbetrag der Ersatzkassen aus. So meldete der zuständige Verband (VDEK) ein Minus von 1,132 Milliarden Euro. Im Jahr zuvor hatten die Kassen noch mit einem Plus von rund 350 Millionen Euro abgeschlossen. Dem Verband gehören unter anderem die Techniker Krankenkasse (TK), die Barmer und die DAK an.
Einen großen Anteil an der Finanzlage der Kassen machte die gesetzlich vorgeschriebene Abschmelzung der Reserven aus, die nun größtenteils auf Mindestmaß liegen. Zudem meldeten mehrere Kassen unerwartet hohe Ausgaben für Krankenhäuser.
“Die Ampel muss sich endlich an ihr Stabilisierungsversprechen erinnern und für eine nachhaltige Finanzierung der GKV sorgen”, sagte die Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbands, Carola Reimann, dem “Handelsblatt” (Donnerstagausgabe). Durch “weitere ausgabensteigernde Gesetzesvorhaben” bestehe die Gefahr, dass sich die Situation zu Lasten der Beitragszahler noch verschärfe.
red