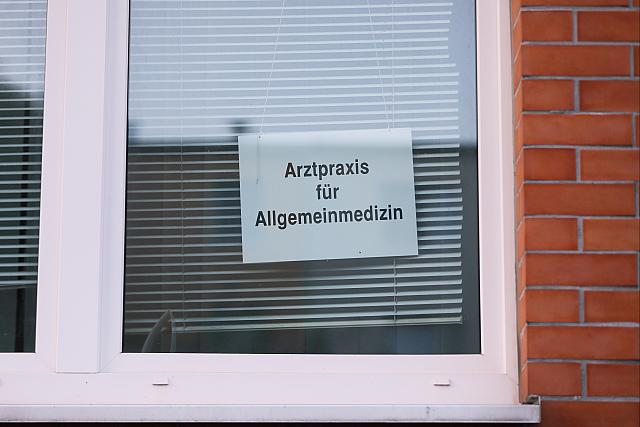Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) fürchtet, dass es wegen Lieferengpässen bei Medikamenten zur Absage von Operationen kommen könnte. Das berichtet das “Handelsblatt”.
Derzeit werden wichtige Mittel für Operationen, allen voran Spül- und Injektionslösungen, Narkose- aber auch Schmerzmittel knapp. Schon Mitte Juni habe in einigen Krankenhäusern die Absage von OPs gedroht, weil Spüllösungen fehlten, heißt es von der DKG. “Wir befürchten, dass es auch in den kommenden Monaten wegen der Situation zur Absage von Operationen kommen kann.”
Die Hersteller von Infusions- und Spüllösungen, B. Braun und Fresenius Kabi, sagten der Zeitung, die Nachfrage sei deutlich gestiegen. Trotz erhöhter Mengen und Vollauslastung haben sie Schwierigkeiten, diese zu bedienen. Krankenhäuser kaufen deswegen zu höheren Preisen Produkte im Ausland zu.
Der Mangel könnte nach Einschätzung von Thomas Preis, Vorsitzender des Apothekerverbands Nordrhein, bald auch in den öffentlichen Apotheken spürbar sein, die ambulant operierende Ärzte und Pflegeheime versorgen, bei denen der Bedarf für Kochsalzlösungen sehr hoch sei.
red