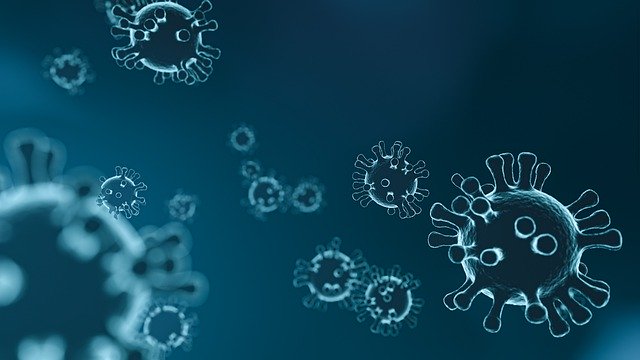Laut dem Landratsamt Ludwigsburg ist die Zahl der Erkrankten seit gestern (18. März) erneut stark gestiegen. Das Kreisgesundheitsamt zählte am Donnerstag insgesamt 176 bestätige Corona-Erkrankungen im Kreis Ludwigsburg. Davon 52 neue Fälle seit gestern. Die Altersspanne liegt laut der Behörde zwischen 4 und 93 Jahren, wovon zur Zeit jetzt neun Personen stationär behandelt werden. Einen Tag zuvor waren es noch sechs Patienten.
Gute Nachricht: Inzwischen wurde bekanntgegeben, dass fünf Personen wieder gesund sind.
Der dringende Appell der Behörden lautet daher weiterhin, die Gefahr ernst zu nehmen und Sozialkontakte auf ein Minimum zu beschränken.
red