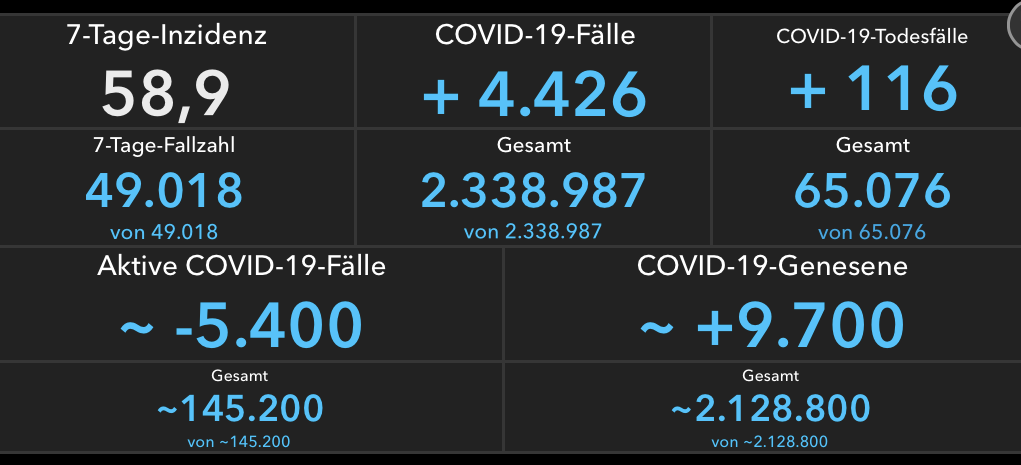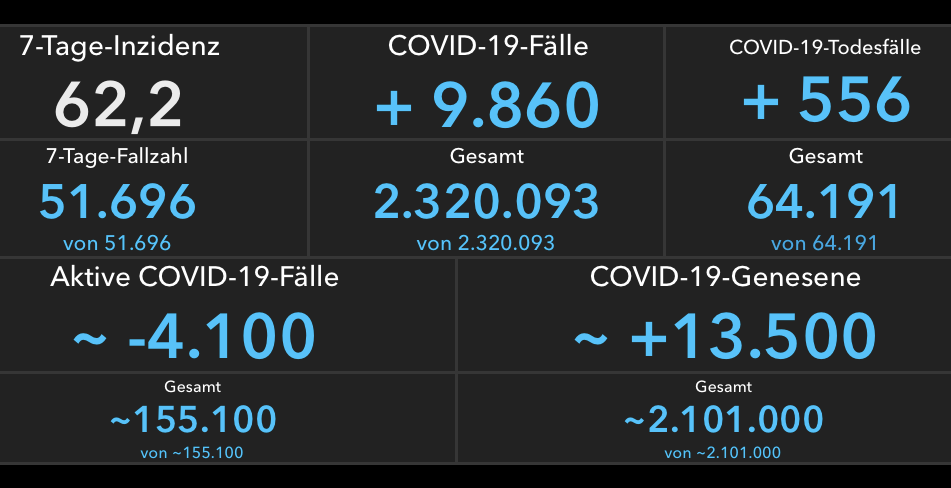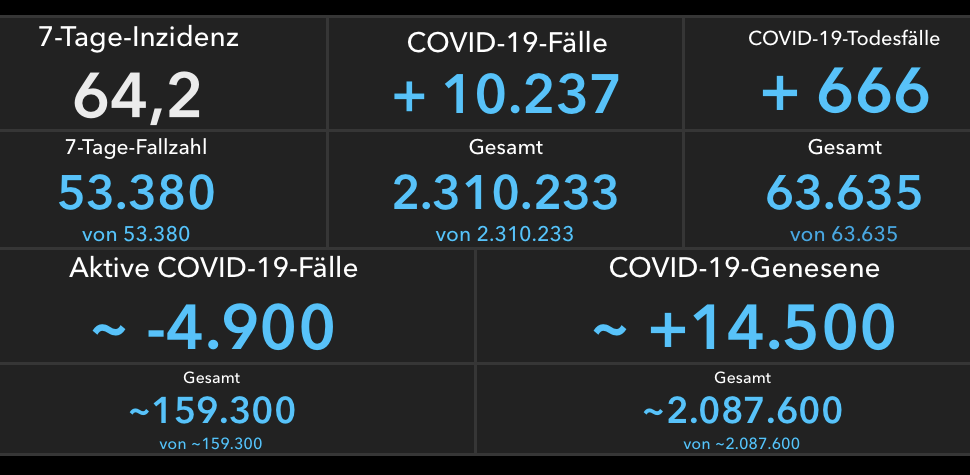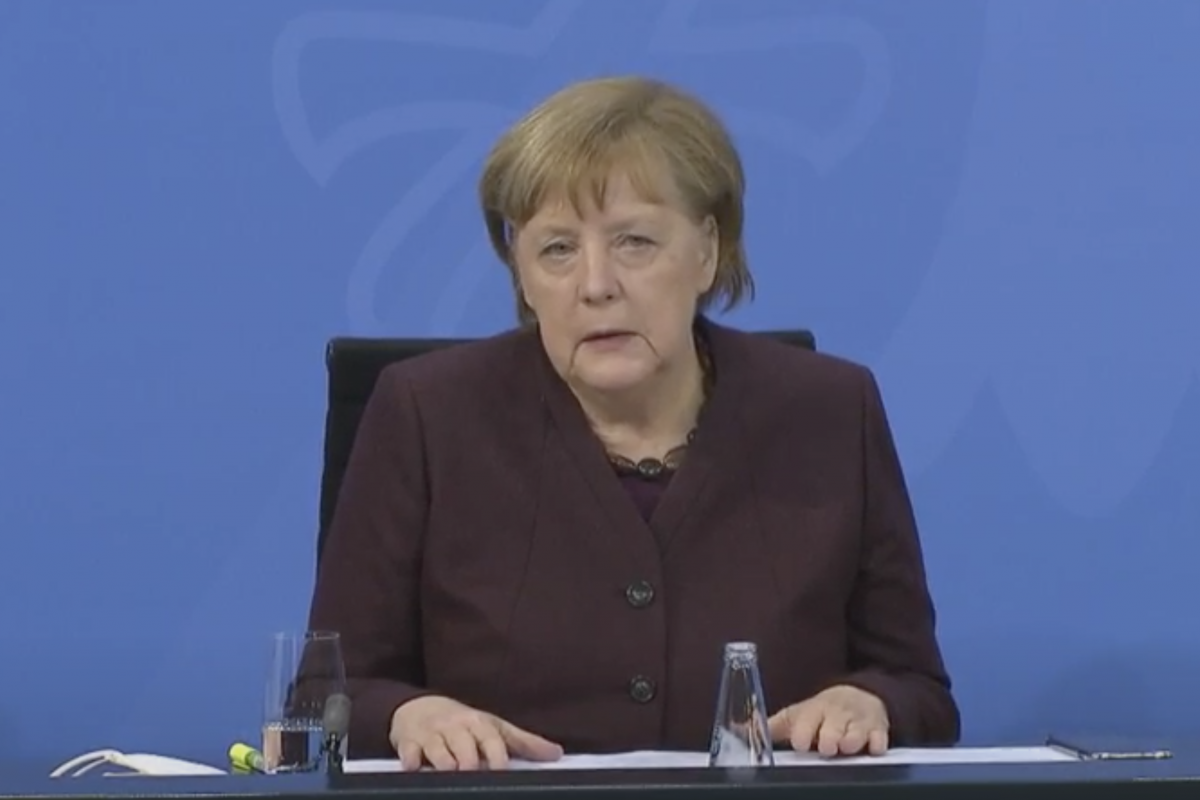Viele Menschen sehnen in der Corona-Krise warme Sonnentrage herbei. Dann hat es das Virus nämlich nicht mehr so leicht bei der Ausbreitung. Doch warum ist das so?
Ganz einfach: Kalte Luft und starke Temperaturschwankungen sind ein entscheidender Auslöser von Virusinfekten, weil die Schleimhäute dann angreifbar werden und Viren diese erste und wichtigste Immunbarriere überwinden können.
Die Verläufe von Atemwegsinfekten sind im Winter am gefährlichsten, weil die Vitamin-D-Spiegel von Januar bis März am niedrigsten sind und Vitamin D eine zentrale Rolle für zahlreiche Funktionen der Immunabwehr spielt.
Tipps zu einer Vermeidung von schweren COVID-19-Verläufen sollten daher viel mehr auf die allgemeine Stärkung des Immunsystems, Vitamin-D-Supplementierung, Vermeidung von Unterkühlungen und den Schutz der Schleimhäute in der Lunge sowie im Hals- und Rachen-Raum abzielen.
Auch kalte Füße tragen indirekt zu einer erhöhten Infektanfälligkeit bei. Eine Studie mit 180 gesunden Personen überprüfte diese alte Weisheit. Die Hälfte der Studenten stellte ihre unbekleideten Füße 20 Minuten lang in zehn Grad kaltes Wasser. Die andere Hälfte durfte Socken und Schuhe anbehalten.
Nach vier bis fünf Tagen bekamen 13 Teilnehmer aus der Wassergruppe eine Erkältung, jedoch nur fünf Teilnehmer aus der Kontrollgruppe. Als Ursache vermuten die Autoren der Studie eine verminderte Durchblutung des Körpers durch das kalte Wasser.
Die Körperoberfläche kühlt aus, und die Blutgefäße in der Nase ziehen sich zusammen. Die reduzierte Durchblutung schwächt die Immunabwehr und macht es den Viren leichter, eine Erkältung auszulösen. Füße sollten daher in der kalten Jahreszeit nach Möglichkeit warmgehalten werden.
Ralf Loweg / glp