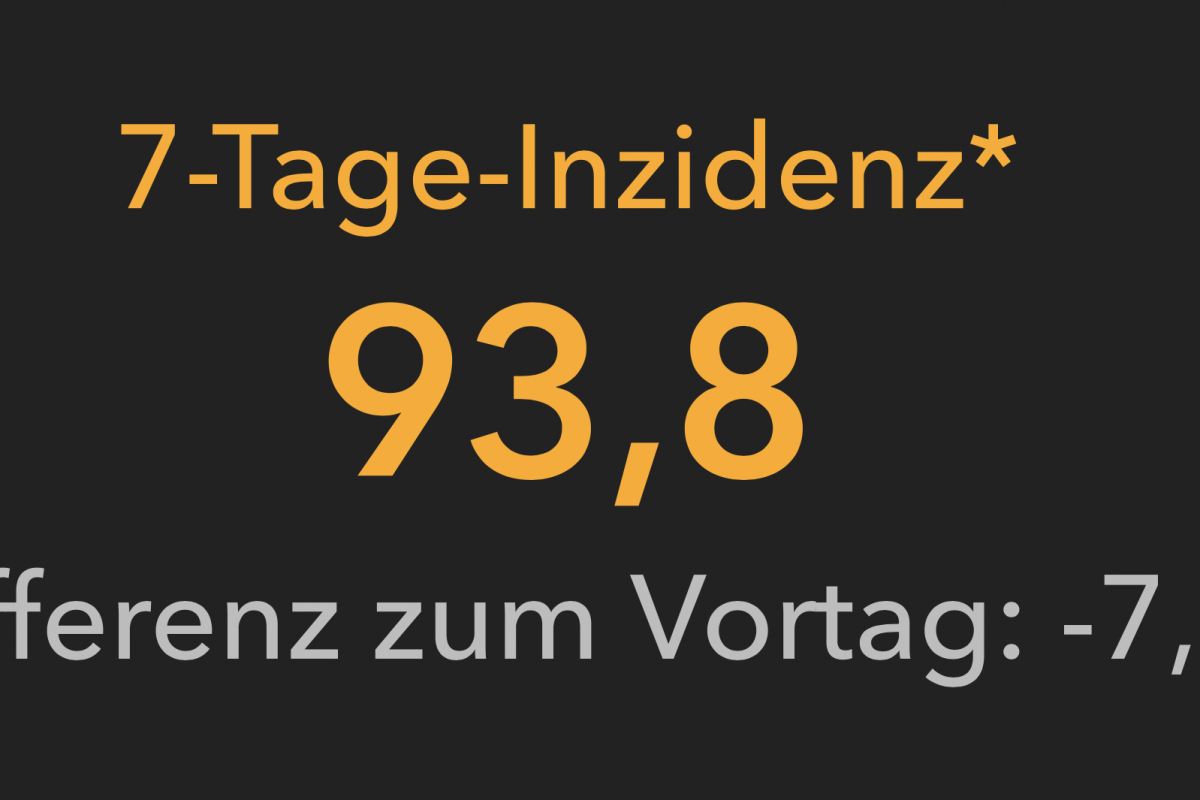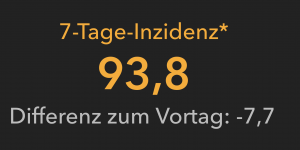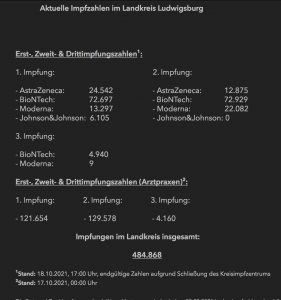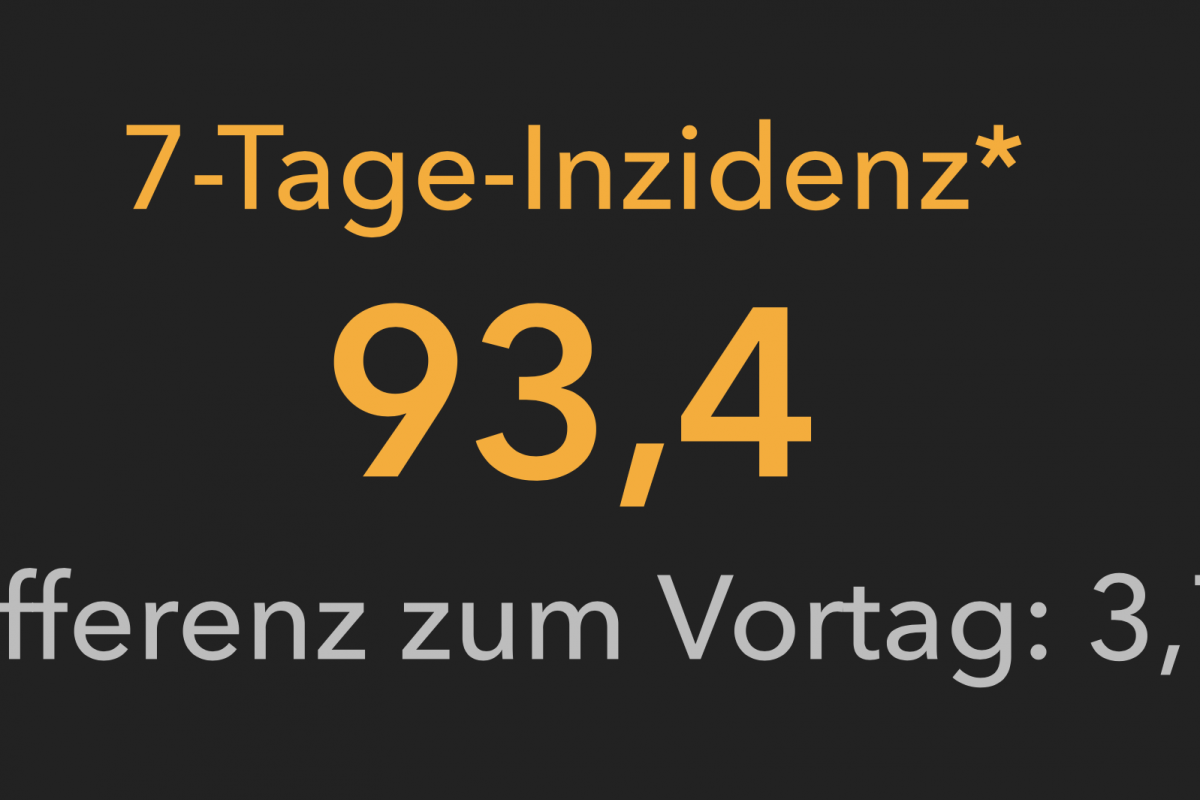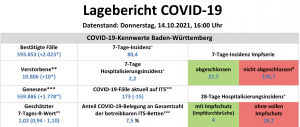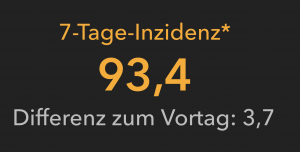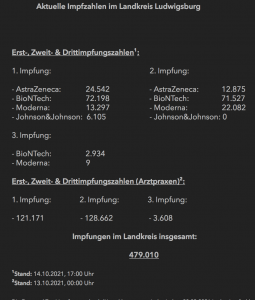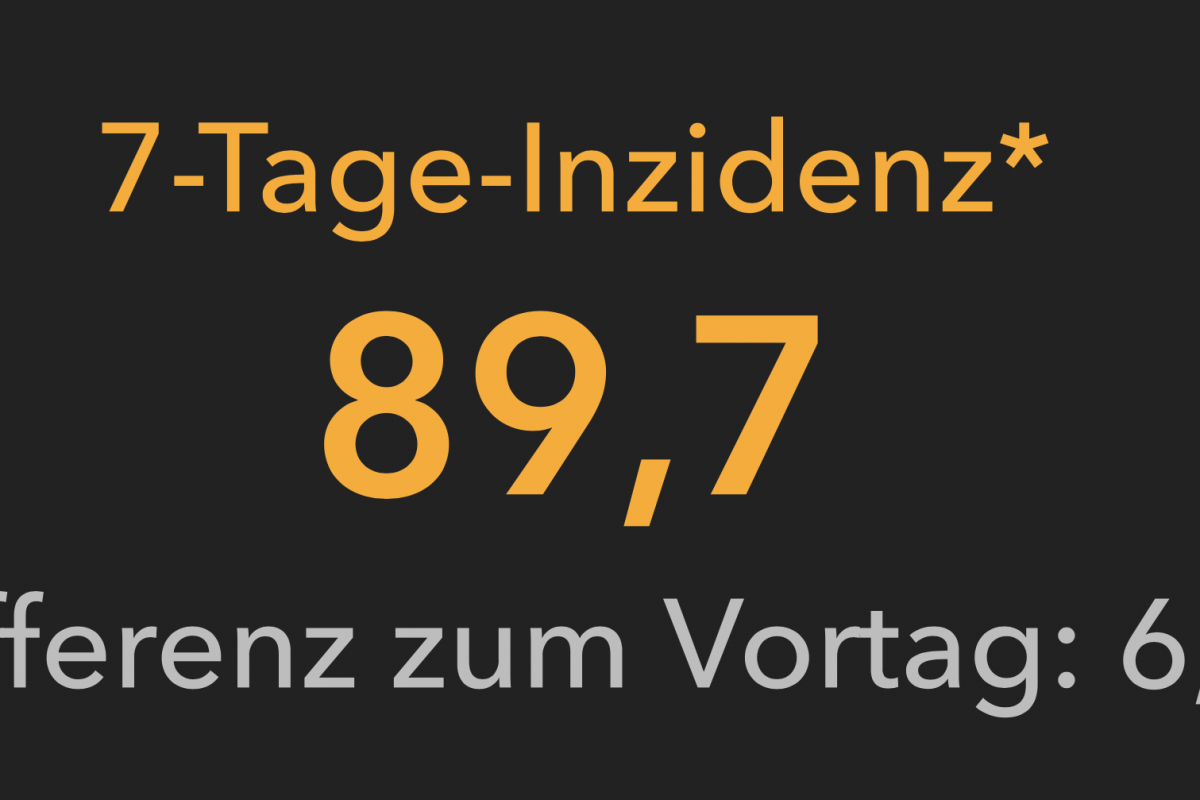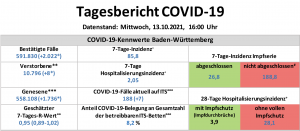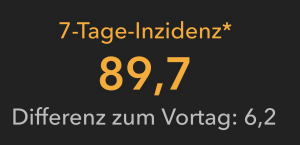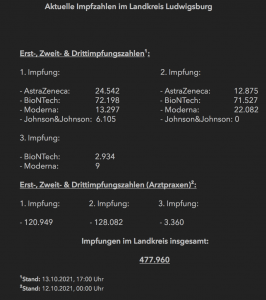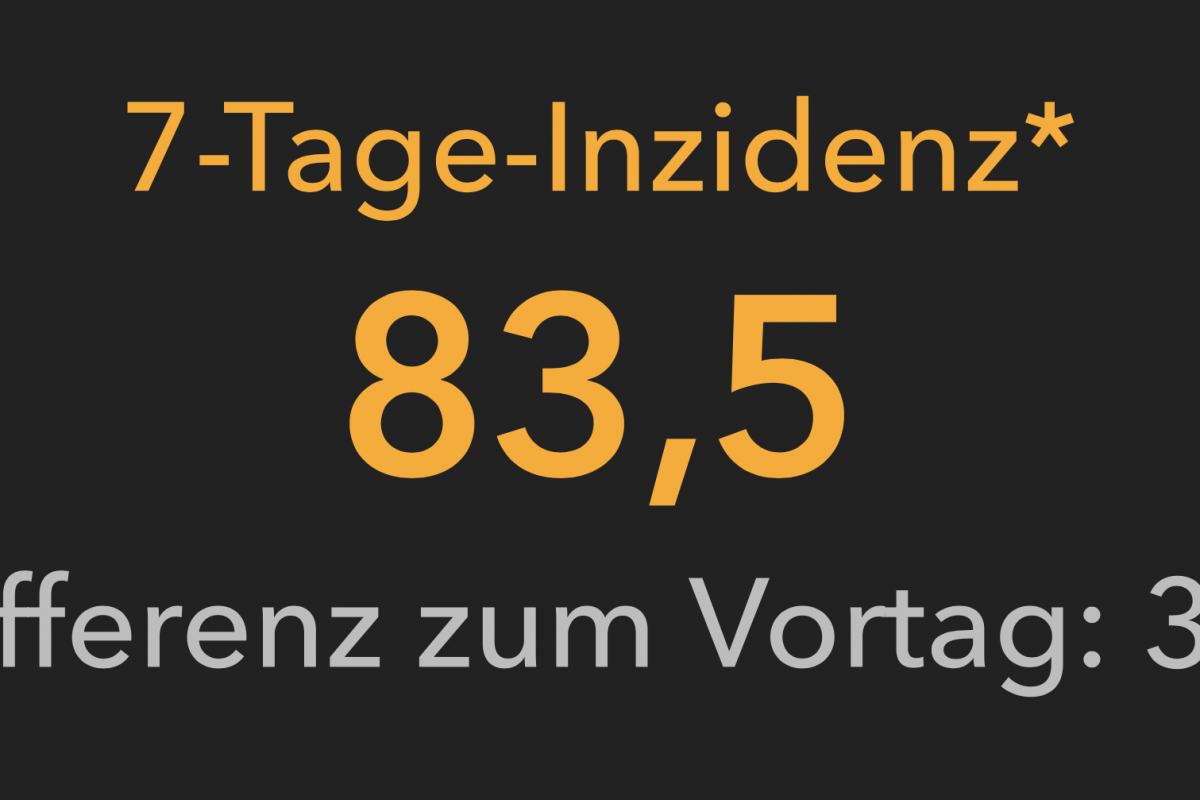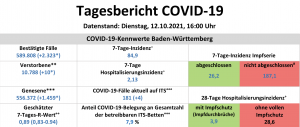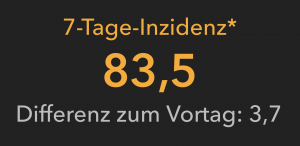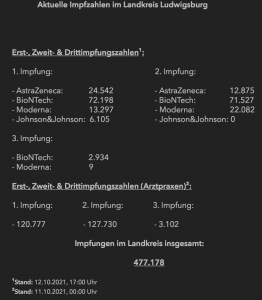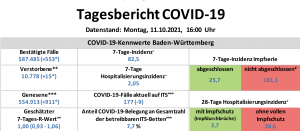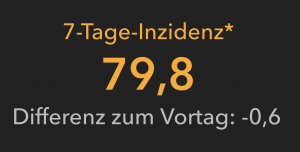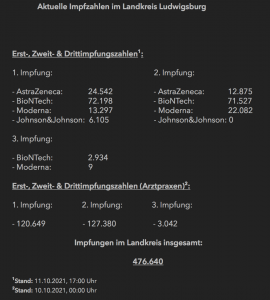In der Pandemie erlebt das Spazieren an der frischen Luft einen Boom. Ob allein oder gemeinsam genossen, ist das Schlendern auch für Untrainierte und Sportmuffel die einfachste und entspannteste Art, sich zu bewegen. Gerade, wenn die Tage im Herbst und Winter kürzer werden und sich das Leben wieder nach drinnen verlagert, ist Bewegung an der frischen Luft besonders wertvoll.
Laut EU-weiten Umfragen verbringen immer mehr Menschen zu viel Zeit im Sitzen: in Schule und Studium, am Arbeitsplatz oder auf dem Sofa. Bereits ab viereinhalb Stunden täglichem Sitzen steigt das Risiko von Herzkreislauferkrankungen. “Doch ein einfacher Spaziergang kann helfen”, betont die promovierte Medizinerin Petra Jürgens vom Medizinisch-Psychologischen Institut des TÜV Nord in Hamburg.
Das zeigten Studiendaten von mehr als 1.800 Männern und Frauen mit chronischen Erkrankungen, von denen sich ein Teil regelmäßig zum Spazieren getroffen hatte. Das Laufen kam nicht nur dem Blutdruck, Cholesterinspiegel und Körperfett zugute. Es senkte ebenso das Risiko von Depressionen, wie eine Langzeitstudie mit 34.000 Erwachsenen zeigt, die zum Untersuchungsbeginn körperlich und psychisch gesund waren. Im Verlauf von elf Jahren entwickelten knapp 1.600 von ihnen eine Depression. Den Analysen zufolge wären zwölf Prozent weniger erkrankt, wenn alle zumindest eine Stunde pro Woche körperlich aktiv gewesen wären – egal, wie intensiv.
Es genügt sogar schon, eine Runde auf einem Uni-Campus oder in einem Uni-Gebäude zu laufen, wie Forschende an der Iowa State University beobachteten. Nach einer zwölfminütigen Tour fühlten sich Studierende im Schnitt heiterer und tatkräftiger als jene, die ebenso lange im Sitzen dieselben Orte auf Fotos oder Videos betrachtet hatten. Die antidepressive Wirkung beruht wahrscheinlich darauf, dass Bewegung einen so genannten Wachstumsfaktor im Blut anreichert, der die Bildung von Nervenzellen fördert.
Eine US-Studie hat den Effekt im Gehirn nachgewiesen. Ältere Erwachsene gingen zunächst dreimal pro Woche zehn Minuten spazieren; im zweiten Monat steigerten sie sich auf 40 Minuten. Die Konzentration des Wachstumsfaktors im Blut stieg, ebenso wie das Volumen von einem Teil des Hippocampus, der Gedächtniszentrale des Gehirns. Bei einer Kontrollgruppe ohne Laufprogramm schrumpfte es hingegen.
Ein Spaziergang an einen beeindruckenden Ort, zum Beispiel mit einer schönen Aussicht, bessert die Gefühlslage offenbar besonders.
Für eine Studie aus dem vergangenen Jahr sollten ältere Versuchspersonen acht Wochen lang wöchentlich einmal eine Viertelstunde spazieren gehen. Die Hälfte sollte dabei gezielt Orte aufsuchen, die Staunen oder Ehrfurcht weckten. Nach eigener Auskunft fühlte sich diese Gruppe nach dem Laufen froher als Spazierende ohne eine solche Instruktion.
“Jede Art von Herumlaufen hilft”, sagt Petra Jürgens von TÜV Nord, “und sei es nur der Gang ins Nachbarbüro.” Gerade nach einem stressigen Tag empfiehlt die Medizinerin aber einen Spaziergang an einen schönen Ort, “um auf andere Gedanken zu kommen”.
Solveig Grewe / alp