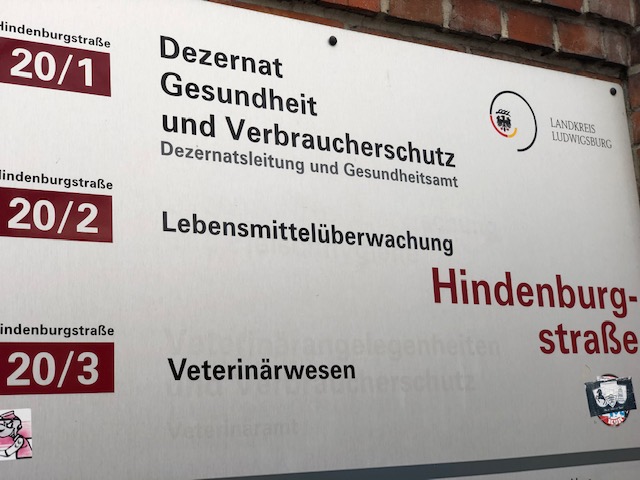Das Sozialministerium in Stuttgart gab am Samstagnachmittag (14. März) aktuelle Zahlen bekannt: Demnach stieg die Zahl der bestätigten Infektionen in Baden-Württemberg innerhalb eines Tages um 258 auf 827 Fälle.
In Stuttgart gibt es laut dem Gesundheitsamt 80 bestätigte Fälle. Das sind 25 mehr als einen Tag zuvor.
Die Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland wird vom Robert-Koch-Institut derzeit insgesamt als mäßig eingeschätzt. Diese Gefährdung variiert laut dem Sozialministerium in Stuttgart jedoch von Region zu Region und ist in „besonders betroffenen Gebieten“ hoch. Diese Einschätzung kann sich kurzfristig durch neue Erkenntnisse ändern. Am 11. März 2020 wurde die weltweite Ausbreitung von COVID-19 von der Gesundheitsorganisation WHO zu einer Pandemie erklärt.
red