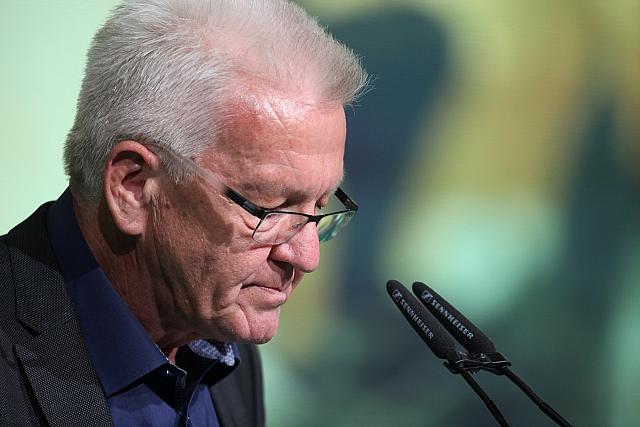Die Europäische Zentralbank (EZB) hat eine weitere Zinserhöhung angekündigt. Bei ihrer Ratssitzung am Donnerstag beschloss die Notenbank, ihre drei Leitzinssätze um 75 Basispunkte anzuheben. Dementsprechend werden der Zinssatz für die Hauptrefinanzierungsgeschäfte sowie die Zinssätze für die Spitzenrefinanzierungsfazilität und die Einlagefazilität mit Wirkung zum 14. September auf 1,25 Prozent, 1,50 Prozent bzw. 0,75 Prozent erhöht.
Erst im Juli hatte die EZB erstmals seit 2011 ihr Leitzinssätze angehoben. “Nach der Anhebung des Zinssatzes für die Einlagefazilität auf einen Wert über null ist das zweistufige System für die Verzinsung von Überschussreserven nicht mehr erforderlich”, schreibt die EZB zu ihrem Beschluss. “Der EZB-Rat hat daher heute beschlossen, das zweistufige System auszusetzen, indem der Multiplikator auf null gesetzt wird”, hieß es.
Dieser “große Schritt” sorge für einen “früheren Übergang von dem derzeitigen, stark akkommodierenden Leitzinsniveau auf ein Niveau, das eine zeitnahe Rückkehr der Inflation auf das mittelfristige Zwei-Prozent-Ziel der EZB gewährleistet”. Der EZB-Rat gehe auf Grundlage seiner aktuellen Einschätzung davon aus, dass er die Zinsen in den nächsten Sitzungen weiter erhöht, um die Nachfrage zu dämpfen und dem Risiko einer andauernden Aufwärtsverschiebung der Inflationserwartungen vorzubeugen, hieß es. “Der EZB-Rat wird seinen geldpolitischen Kurs regelmäßig neu bewerten und dabei aktuelle Daten sowie die Entwicklung der Inflationsaussichten berücksichtigen. Die Leitzinsbeschlüsse des EZB-Rats werden auch in Zukunft von der Datenlage abhängen und werden von Sitzung zu Sitzung festgelegt.”
red