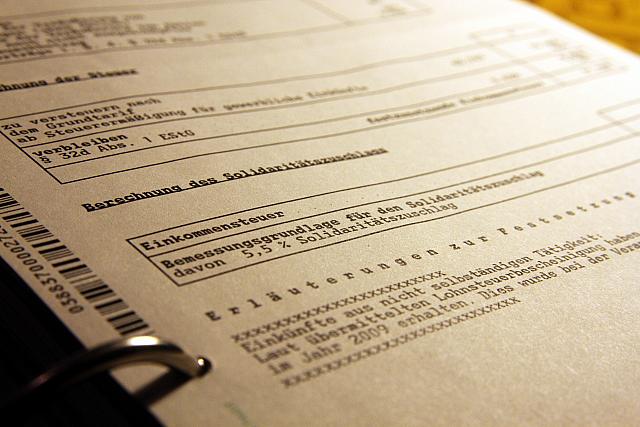Der Sozialverband VdK hält die bisherigen Entlastungspakete der Bundesregierung für nicht ausreichend und fordert eine Inflations-Nothilfe für jeden Bürger. “Die Menschen, die unter der hohen Inflation besonders leiden, brauchen unbürokratische Hilfen. Der VdK fordert daher: 300 Euro für alle”, sagte VdK-Präsidentin Verena Bentele der “Rheinischen Post” (Donnerstag).
Bei vielen, die dringend Unterstützung brauchen, kämen die bisherigen Hilfen nicht an. “Rentner gehen bei der Energiepreispauschale leer aus, ebenso wie die Empfänger von Krankengeld, Übergangsgeld oder Elterngeld. Stattdessen wird sie an Spitzenverdiener ausgezahlt. Bezieher von Sozialleistungen werden unterschiedlich behandelt: Ein Ehepaar im Hatz-IV-Bezug erhält insgesamt 400 Euro, viele Ehepaare in Grundsicherung im Alter bekommen dagegen nur 200 Euro”, kritisierte Bentele. Und das Neun-Euro-Ticket nutze Menschen auf dem Land, wenn dort kein Bus fährt, nichts.
red / dts