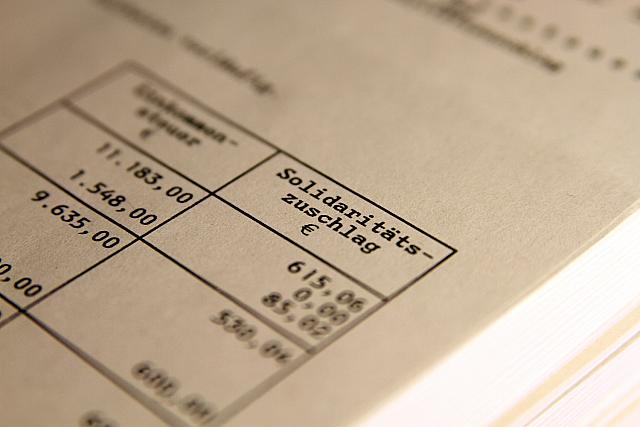Im Jahr 2022 sind mehr als doppelt so viele Menschen von den 23 größten deutschen Verkehrsflughäfen gestartet oder gelandet als im Vorjahr. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch mitteilte, zählten die Flughäfen rund 155,2 Millionen Passagiere. Das entsprach einem Zuwachs von 111,0 Prozent gegenüber dem stärker von der Corona-Pandemie geprägten Jahr 2021.
Vom Vorkrisenniveau des Jahres 2019, als die Hauptverkehrsflughäfen mit 226,7 Millionen Fluggästen ein Allzeithoch verzeichnen konnten, war das Passagieraufkommen mit 31,5 Prozent weniger Fluggästen aber noch weit entfernt. Nach dem Ende der pandemiebedingten Reisebeschränkungen entwickelten sich der Verkehr mit dem Ausland und der innerdeutsche Verkehr im Jahr 2022 unterschiedlich: Der innerdeutsche Verkehr nahm mit +98,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr nur unterdurchschnittlich zu. Der Verkehr mit dem Ausland verzeichnete dagegen einen Zuwachs von 111,9 Prozent.
Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 war der innerdeutsche Luftverkehr damit immer noch um 59,5 Prozent geringer und erreichte lediglich gut zwei Fünftel des Vorkrisenniveaus. Der Luftverkehr mit dem Ausland lag dagegen nur um 28,3 Prozent unter dem Wert des Jahres 2019. An den deutschen Hauptverkehrsflughäfen wurden 2022 mit 4,9 Millionen Tonnen zwar 6,7 Prozent weniger Fracht transportiert als im Jahr 2021 (5,3 Millionen Tonnen). Dennoch bedeutete dies einen Zuwachs um 5,2 Prozent gegenüber dem Jahr 2019 (4,7 Millionen Tonnen).
red