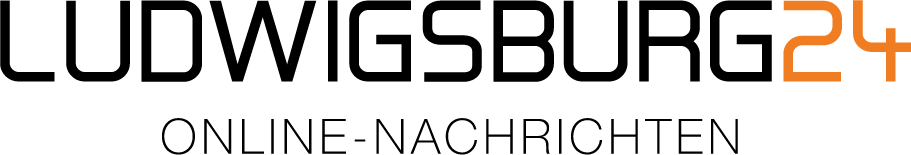Mainz – Die deutsche Pharmaindustrie wird über Jahre hinweg von Impfstoffen gegen das Coronavirus profitieren. Das berichtet der “Spiegel” in seiner neuen Ausgabe. Bis 2030 dürfte sich der finanzielle Effekt auf rund 16 Milliarden Euro belaufen, so das Fazit einer bisher unveröffentlichten Studie im Auftrag des Verbandes forschender Arzneimittelhersteller (VfA).
Schätzungsweise “57.000 Beschäftigungsjahre” dürften in den nächsten acht Jahren durch die Impfstoffproduktion in Deutschland entstehen. Auch sonst erwies sich die Pharmaindustrie in Deutschland laut der Lobbystudie als krisenfest. Durch den vom Mainzer Unternehmen Biontech maßgeblich mitentwickelten Impfstoff Comirnaty flossen allein aus Lizenzeinnahmen Gelder im oberen zweistelligen Milliardenbereich in den hiesigen Standort und sorgten für Wirtschaftswachstum.
2021 generierte die Pharmaindustrie in Deutschland direkt und indirekt eine Bruttowertschöpfung von rund 33,6 Milliarden Euro, gab gut 278.000 Menschen Arbeit und sorgte für 11,7 Milliarden Euro Steuereinnahmen, so die Studie. Trotz dieser Jubelzahlen ist die deutsche Pharmaindustrie längst nicht mehr so relevant wie früher. Einst bedeutende Unternehmen sind in Fusionen aufgegangen oder verschwunden, und die Rolle der einstigen “Apotheke der Welt” übernehmen zumeist andere Länder.
Beim Lobbyverband sieht man durch die mRNA-Technologie, auf der auch der Covid-19-Impfstoff von Biontech beruht, große Hoffnung für die Zukunft. Sowohl in der Entwicklung darauf basierender Medikamente, etwa in der Onkologie, als auch in der Herstellung steckten “enorme volkswirtschaftliche Wachstumspotentiale”, hieß es.
red