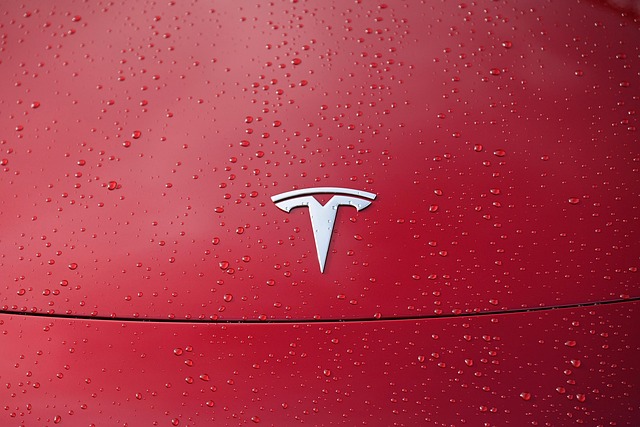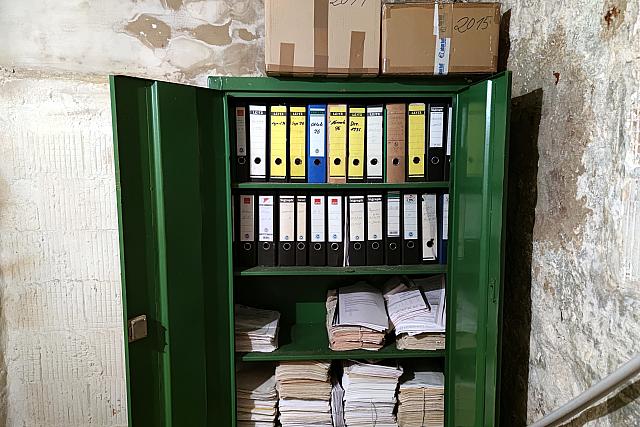Die neuen US-Zölle zeigen erste wirtschaftliche Folgen: Die Zahl europäischer Touristen in den USA ist spürbar gesunken, vor allem aus Deutschland und Spanien. Gleichzeitig steigen die Kosten für Flugzeuge, während Airlines mit schwächer ausgelasteten Transatlantikverbindungen zu kämpfen haben. Trotz robuster Kerosinpreise und steigender Umsätze bleibt die Unsicherheit hoch.
Wien (red) – Die neuen US-Zölle haben erhebliche Auswirkungen auf die europäische Luftfahrt- und Tourismusbranche. Laut einer Analyse des Kreditversicherers Acredia in Zusammenarbeit mit Allianz Trade sind die Flugreisen in die USA deutlich zurückgegangen, während die Betriebskosten für Airlines gestiegen sind. “Die politische Unsicherheit und höhere Preise für Flugzeuge bremsen die Branche aus”, teilte Michael Kolb von Acredia mit.
Im März 2025 ist die Zahl der westeuropäischen Touristen in den USA um 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Besonders stark war der Rückgang bei Reisenden aus Deutschland (-28 Prozent) und Spanien (-25 Prozent). Die Auslastung auf Transatlantikflügen sank von 84 auf 78 Prozent. Diese Strecken gehören zu den profitabelsten Verbindungen der Airlines.
Trotz der Herausforderungen rechnet Acredia für europäische Fluggesellschaften 2025 mit einem Umsatzwachstum von durchschnittlich zehn Prozent. Grund sind gesunkene Kerosinpreise und robustere Margen. Allerdings leiden die Airlines unter langen Lieferzeiten für neue Flugzeuge und steigenden Preisen, die bis 2030 um bis zu 20 Prozent zulegen könnten.