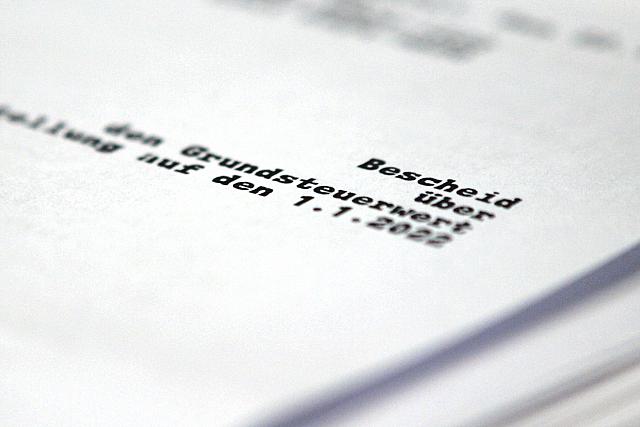Im ersten Halbjahr 2023 sind in Deutschland 233,9 Milliarden Kilowattstunden Strom erzeugt und in das Netz eingespeist worden. Das waren 11,4 Prozent weniger Strom als im ersten Halbjahr 2022, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen am Mittwoch mit. Aufgrund deutlich gestiegener Importe (+30,8 Prozent) und gesunkener Exporte (-18,1 Prozent) sank die insgesamt im Netz verfügbare Strommenge allerdings nur um 6,9 Prozent und damit schwächer als die inländische Stromerzeugung.
Dennoch überstiegen die deutschen Stromexporte (32,6 Milliarden Kilowattstunden) auch im ersten Halbjahr 2023 die Stromimporte (30,6 Milliarden Kilowattstunden). Gründe für den Rückgang der insgesamt verfügbaren Strommenge waren Einsparbemühungen wegen hoher Energiepreise und eine konjunkturelle Abschwächung, insbesondere in den energieintensiven Industriezweigen. Der im Vergleich zur insgesamt verfügbaren Strommenge stärkere Rückgang inländischen Stromerzeugung hängt zudem mit der Abschaltung der letzten drei deutschen Kernkraftwerke zum 15. April 2023 zusammen: Der Wegfall der Kernenergie wurde vor allem durch vermehrte Stromimporte ausgeglichen, während die Stromerzeugung aus Kohle deutlich sank.
Der im ersten Halbjahr 2023 in Deutschland erzeugte und in das Netz eingespeiste Strom stammte trotz eines Rückgangs um 2,2 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022 mit 53,4 Prozent mehrheitlich aus erneuerbaren Energiequellen (erstes Halbjahr 2022: 48,4 Prozent), so die Statistiker. Die Einspeisung von Strom aus konventionellen Energieträgern sank um 19,9 Prozent auf einen Anteil von 46,6 Prozent (erstes Halbjahr 2022: 51,6 Prozent). Die Stromerzeugung aus Windkraft ging gegenüber dem ersten Halbjahr 2022 um 1,2 Prozent zurück.
Wegen der insgesamt geringeren Stromerzeugung stieg der Anteil der Windenergie am inländisch erzeugten Strom dennoch von 25,6 Prozent auf 28,6 Prozent im ersten Halbjahr 2023. Damit war die Windkraft der wichtigste Energieträger in der Stromerzeugung. Die Stromeinspeisung aus Photovoltaik sank um 5,9 Prozent, ihr Anteil an der gesamten Einspeisung stieg jedoch auf 11,9 Prozent (erstes Halbjahr 2022: 11,2 Prozent). Der Rückgang der Einspeisung aus Photovoltaik erklärt sich vor allem damit, dass diese im ersten Quartal 2022 aufgrund ungewöhnlich vieler Sonnenstunden sehr hoch gewesen war.
Die in Kohlekraftwerken erzeugte Strommenge ging im ersten Halbjahr 2023 um 23,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf einen Anteil von 27,1 Prozent an der gesamten Stromerzeugung zurück. Damit war der Anteil von Kohlestrom wieder niedriger als der Anteil des Stroms aus Windkraft, nachdem Kohle im ersten Halbjahr 2022 mit einem Anteil von 31,3 Prozent noch der wichtigste Energieträger in der Stromerzeugung gewesen war. Die Stromerzeugung aus Erdgas stieg dagegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3,8 Prozent auf einen Anteil von 13,9 Prozent an der Stromerzeugung (erstes Halbjahr 2022: 11,9 Prozent).
Strom aus Kernenergie machte aufgrund der Abschaltung der letzten drei Kernkraftwerke zum 15. April 2023 nur noch 2,9 Prozent der inländischen Stromerzeugung aus (erstes Halbjahr 2022: 6,0 Prozent). Bis zur Abschaltung speisten diese Kraftwerke noch 9,1 Milliarden Kilowattstunden Strom ins Netz ein – das waren 57,5 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2022, als die drei Kernkraftwerke noch über das gesamte Halbjahr in Betrieb waren. Die nach Deutschland importierte Strommenge stieg im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022 um 7,2 Milliarden auf 30,6 Milliarden Kilowattstunden (+30,8 Prozent), wie das Bundesamt weiter mitteilte.
Demgegenüber sank die exportierte Strommenge um 7,3 Milliarden auf 32,6 Milliarden Kilowattstunden (-18,1 Prozent). Damit verringerte sich der deutsche Exportüberschuss gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich von 16,5 Milliarden auf 2,0 Milliarden Kilowattstunden. Betrachtet man nur das zweite Quartal 2023, in dem die Kernkraftwerke bis zum Abschalten am 15. April 2023 nur noch 1,0 Milliarden Kilowattstunden Strom erzeugten, wurde mit 18,5 Milliarden Kilowattstunden deutlich mehr Strom importiert als exportiert (11,4 Milliarden Kilowattstunden).
Dieser Importüberschuss von 7,1 Milliarden Kilowattstunden entspricht etwa der Strommenge, die im zweiten Quartal 2022 noch von den drei Kernkraftwerken eingespeist worden war (7,3 Milliarden Kilowattstunden). Die meisten Stromimporte kamen im ersten Halbjahr 2023 mit 4,7 Milliarden Kilowattstunden aus den Niederlanden (+37,6 Prozent zum ersten Halbjahr 2022). Den stärksten Anstieg bei den Importen verzeichnete Frankreich.
Von dort wurden 4,4 Milliarden Kilowattstunden Strom importiert (+147,8 Prozent), nachdem die Stromimporte aus Frankreich im ersten Halbjahr 2022 nach Problemen in den dortigen Kernkraftwerken deutlich zurückgegangen waren (-58,9 Prozent zum ersten Halbjahr 2021). Damals waren die Stromexporte nach Frankreich höher als die Stromimporte aus Frankreich nach Deutschland.
red