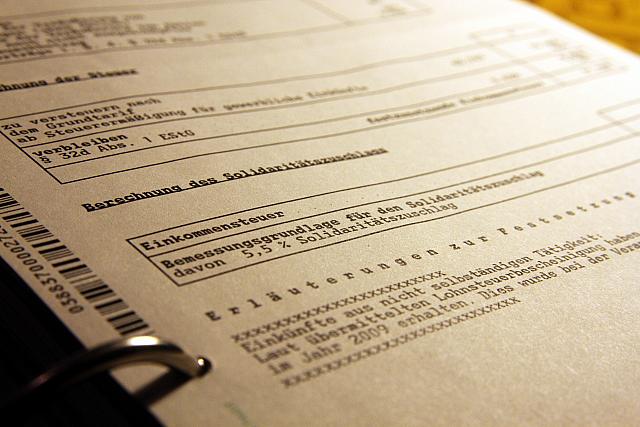Katar will Deutschland früher verflüssigtes Erdgas (LNG) liefern als bislang bekannt. “Wir wollen unsere US-Flüssiggasanlage Golden Pass in Texas, an dem Qatar Energy 70 Prozent hält, bereits 2024 so weit haben, dass wir nach Deutschland liefern können”, sagte der Vizepremier des Golfstaats, Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, dem “Handelsblatt”. Zusätzliche Gasmengen kämen dann etwas später hinzu: “Die Erweiterung der Förderung in unserem Gasfeld North Dome wird 2026 abgeschlossen sein, vielleicht sogar schon 2025.”
North Dome ist das weltgrößte Gasfeld, das sich Katar und der Iran unter dem Persischen Golf teilen. Bis spätestens 2026 soll die katarische Gasförderung daraus von derzeit 77 auf 126 Millionen Tonnen LNG gesteigert werden. Bisher hatte es geheißen, dass der weltgrößte Flüssiggas-Exporteur Deutschland erst mit großen Mengen beliefern könne, wenn der Staatskonzern Qatar Energy die Förderung auf 126 Millionen Tonnen LNG jährlich erhöht habe.
Deutschland will sich von russischem Gas unabhängig machen und setzt dabei auch auf Flüssiggas-Lieferungen. An diesem Freitag trifft sich der Emir Katars, Scheich Tamin bin Hamad Al-Thani, zu Gesprächen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Berlin. Bei dem Staatsbesuch wird es auch um weitere Milliarden-Investitionen in deutsche Unternehmen gehen.
Nach Engagements bei Volkswagen, der Deutschen Bank, Siemens Energy, Curevac oder Hapag-Lloyd ist Katar bereits der größte Investor aus dem Mittleren Osten in der deutschen Wirtschaft. Zudem soll ein Militärabkommen geschlossen werden.
red / dts