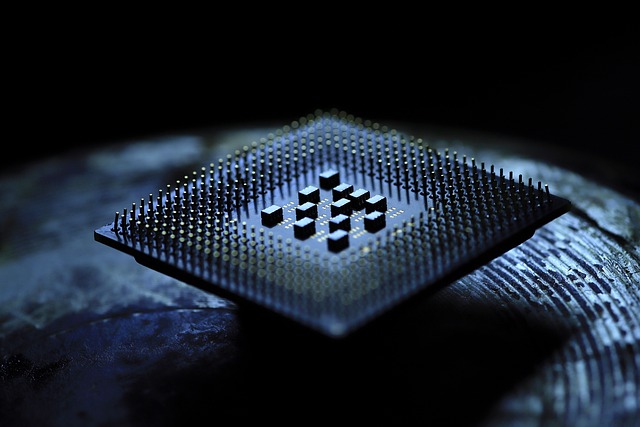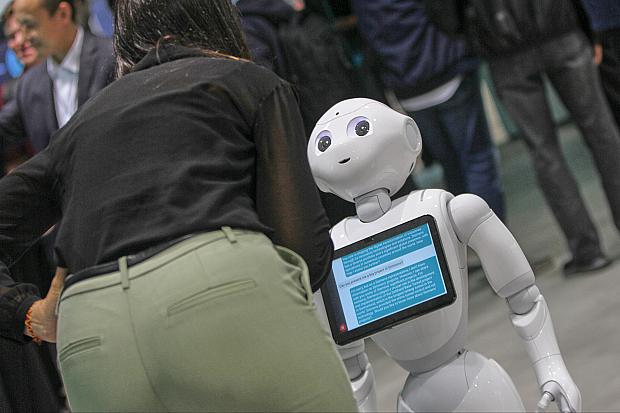Die Bundesregierung will trotz knapper Kassen an der geplanten Chip-Förderung festhalten. Insgesamt 25 Projekte gelten als förderfähig – doch ein Mega-Vorhaben des Dresdner Unternehmens FMC könnte den Großteil der Mittel beanspruchen. In Europa wäre es die erste Serienproduktion für Speicherchips.
Berlin (red) – Die neue Bundesregierung will an dem Plan festhalten, zwei Milliarden Euro in die Förderung von Chipfabriken zu investieren. Das Geld hatte bereits die Vorgängerregierung im Klima- und Transformationsfonds (KTF) hinterlegt: “Die Förderung der Projekte ist mit den im KTF hinterlegten zwei Milliarden Euro geplant”, sagte eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums dem “Handelsblatt”.
Das Wirtschaftsministerium hatte im November 2024 eine Ausschreibung für Förderungen im Rahmen des europäischen Chips-Acts durchgeführt. Darauf haben sich nach Informationen des “Handelsblatts” aus Regierungskreisen Unternehmen mit insgesamt 34 Projekten gemeldet. 25 davon wurden als grundsätzlich förderfähig eingestuft. Darunter sind Vorhaben von X-Fab, Vishay, Semikron Danfoss, Aixtron, AMTC, Carl Zeiss, Infineon und Siltronic.
Das mit Abstand größte Projekt auf der Liste ist das des Unternehmens “Ferroelectric Memory Company”, kurz FMC. Das Dresdner Unternehmen plant den Regierungskreisen zufolge den Bau seines ersten Halbleiterwerks in Deutschland. Es wäre die einzige Speicherchip-Serienproduktion in ganz Europa. FMC soll sich demnach Flächen in Magdeburg, Pirna und Frankfurt/Oder anschauen.
FMC fordere für die Ansiedlung allerdings eine staatliche Förderung in Höhe von 1,3 Milliarden Euro, heißt es. Sollte die Regierung dem stattgeben, kann sie voraussichtlich nicht alle der anderen Projekte fördern, die gemeldet wurden. Die Ministeriumssprecherin sagte, man führe “aktuell mit mehreren Unternehmen Gespräche”, machte dazu aber keine Angaben. FMC ließ Anfragen unbeantwortet, schreibt das “Handelsblatt”.