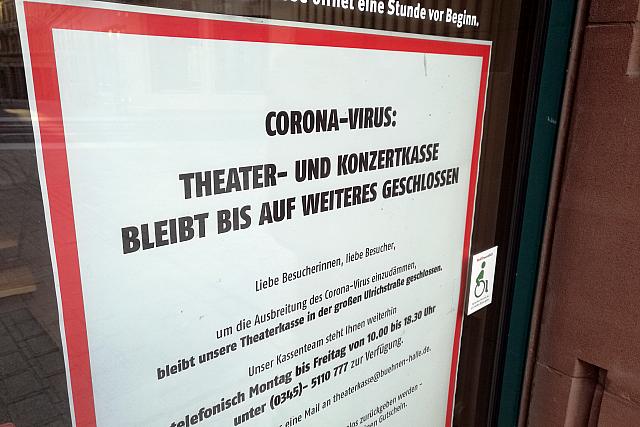Bund, Kommunen und Gewerkschaften haben sich im Streit um mehr Geld für die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst in der vierten Verhandlungsrunde geeinigt. Das teilten die Verhandlungspartner am späten Samstagabend in Potsdam mit. Die Regelung sehe je nach bisherigem Einkommen Erhöhungen zwischen 8 und 16 Prozent vor, hieß es, die Vertragslaufzeit soll 24 Monate betragen.
Konkret soll ab Juni stufenweise ein steuer- und sozialabgabenfreies Inflationsausgleichsgeld in Höhe von 3.000 Euro ausgezahlt werden, ab dem 1. März 2024 folgt eine Erhöhung der Tabellenentgelte um 200 Euro und anschließend um 5,5 Prozent. Ausbildungs- und Praktikantenentgelte werden zum gleichen Zeitpunkt um 150 Euro erhöht. Vom Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TVöD) sind insgesamt über 2,5 Millionen Beschäftigte direkt oder indirekt betroffen: Fast 1,6 Millionen Arbeitnehmer des Bundes und der Kommunen und weiterer Bereiche, für die der TVöD direkte Auswirkungen hat, sowie Auszubildende, 6.350 beim Bund und 56.300 bei den Kommunen, dazu Praktikanten sowie Studierende in ausbildungsintegrierten dualen Studiengängen und auch knapp 190.000 Bundesbeamte, Anwärter sowie über 500.000 Versorgungsempfänger beim Bund, auf die der Tarifabschluss übertragen werden soll.
Mittelbar hat die Einkommensrunde auch Auswirkungen für weitere Bereiche des öffentlichen Dienstes, beispielsweise die Bundesagentur für Arbeit und die Deutsche Rentenversicherung.
red