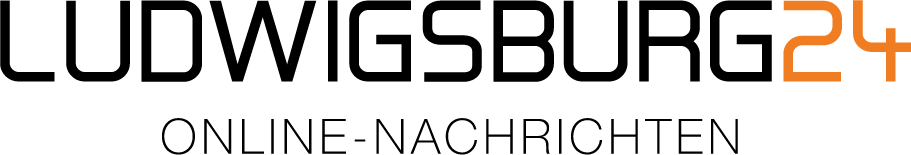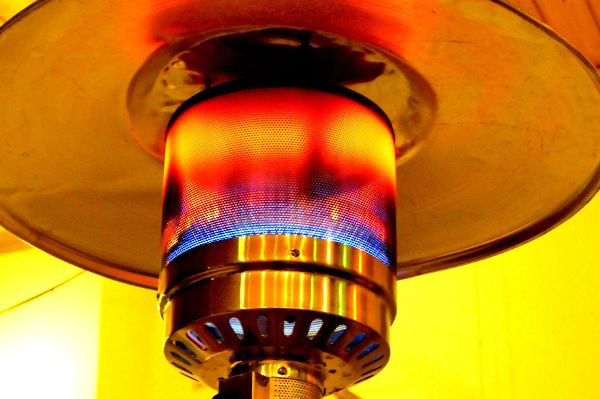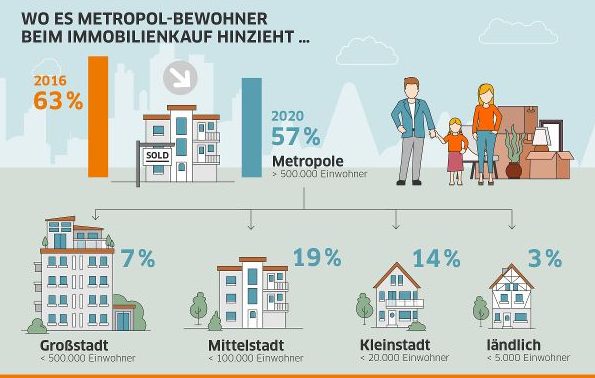Im bundesweiten Tarifkonflikt um die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) hat die Gewerkschaft (ver.di) am Dienstag, dem 29. September 2020, zu einem bundesweiten Warnstreik aufgerufen um den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen. Hintergrund ist, dass die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber (VKA) abgelehnt hat, mit der Gewerkschaft in Verhandlungen einzutreten.
Daher werden am Dienstag, 29. September 2020, die Stuttgarter Straßenbahnen bestreikt. Betroffen vom Streik sind alle Stadtbahnen (U1 bis U34) und SSB-Busse (zweistellige Liniennummern), die normalerweise im Stadtgebiet Stuttgart, zum Teil auf den Fildern, nach Sindelfingen, Fellbach, Remseck, Leonberg, Gerlingen und Nürtingen fahren.
Am gesamten Betriebstag werden daher weder Busse noch Bahnen der SSB fahren. Betroffen sind auch die Seil- und die Zahnradbahn. Die Kundenzentren der SSB und die Fundstelle bleiben geschlossen, gab die SSB an.
Bus-Linien die von Privaten-Busunternehmen befahren werden, sind vom Streik nicht betroffen, teilte die SSB mit:
Folgende Linien fahren daher planmäßig:
53 Mühlhausen – Zuffenhausen
54 Freiberg – Neugereut
58 Schmiden – Obere Ziegelei
60 Oeffingen – Untertürkheim
64 Stelle – Frauenkopf
66 Kühwasen – Geschwister-Scholl-Gymnasium
73 Degerloch – Neuhausen
90 Korntal – Giebel
Die Kundenzentren der SSB am Charlottenplatz, Rotebühlplatz und Hauptbahnhof werden am Dienstag ebenfalls bestreikt und daher geschlossen sein. Der SSB-Telefonservice kann ebenfalls vom Streik betroffen sein. In diesem Fall können sich Fahrgäste stattdessen an die Mitarbeiter des VVS-Callcenters unter 0711 19449 wenden, die montags bis freitags von 8 bis 18:00 Uhr erreichbar sind, oder rund um die Uhr an die landesweite Fahrplanauskunft unter 01805 77 99 66 (14 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz) sowie die regionale Mobilitätsnummer 0711 320 66 222. Die Reisezentren der DB sind nicht vom Streik betroffen.
Die Stuttgarter Fahrgäste können im Stadtgebiet die vom Streikaufruf nicht betroffenen S-Bahnen und Regionalzüge nutzen, heißt es in der Mitteilung weiter.
Hintergrundinfo:
ver.di fordert in dem Tarifkonflikt für bundesweit 87.000 Beschäftigte Regelungen zur Nachwuchsförderung und zur Entlastung der Beschäftigten. In dem bundesweiten Rahmentarifvertrag soll zudem die Ungleichbehandlung in den Bundesländern beendet werden. Konkret geht es dabei um zentrale Regelungen wie 30 Urlaubstage oder Sonderzahlungen. Mit einer Forderung für Auszubildende sollen Anreize zum Einstieg in den Beruf und zur Nachwuchsförderung geschaffen werden. Seit März fordert die Gewerkschaft hierzu die Verhandlung eines bundesweiten Rahmentarifvertrages. Am Wochenende hatte sich die VKA gegen die Aufnahme von Verhandlungen ausgesprochen.
red