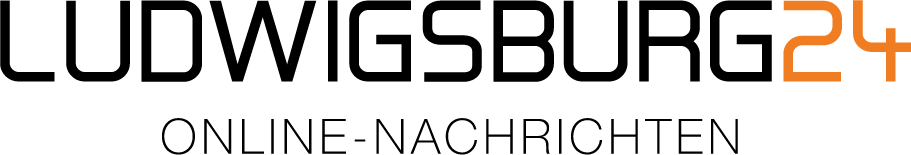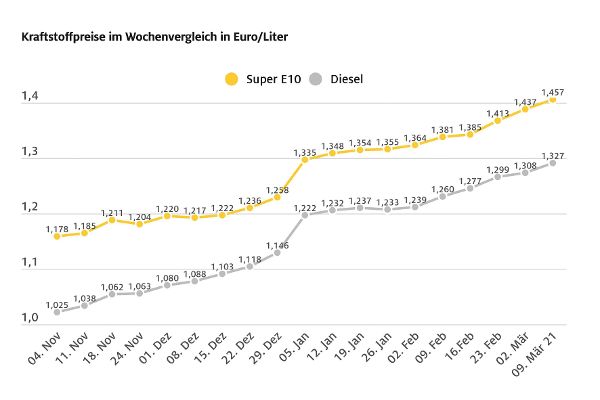Die Corona-Krise beeinflusste und beeinflusst die deutsche Fahrrad- und E-Bike-Industrie signifikant. Hersteller und Fahrradhandel mussten sich im Jahr 2020 vor dem Hintergrund von Shutdowns, gestörten Lieferketten, Ladenschließungen, Hygieneauflagen und beispielloser Nachfrage enormen Herausforderungen stellen. So heißt es beim Zweirad-Industrie-Verband (ZIV).
Doch das ist natürlich nur die eine Seite der Medaille. Zwar konnte sich die Branche schon in den vergangenen Jahren über ein dynamisches Wachstum freuen. Wegen Corona ging es aber 2020 erst so richtig los: “Zweiräder, mit und ohne elektrischen Antrieb, waren und sind die Verkehrsmittel der Stunde und konnten von der beispiellosen Situation des vergangenen Jahres stark profitieren”, so das Fazit des ZIV.
In Zahlen: Der Absatz an Fahrrädern und E-Bikes lag 2020 mit 5,04 Millionen Exemplaren um 16,9 Prozent über dem von 2019. Der Anteil der E-Bikes von 1,95 Millionen entspricht 38,7 Prozent. Das bedeutet: Im Jahre 2020 wurden 43,4 Prozent mehr E-Bikes verkauft als 2019.
Der Gesamtumsatz lag 2020 bei 6,44 Milliarden Euro, das ist ein Plus von 60,9 Prozent gegenüber 2019. Und der durchschnittliche Verkaufspreis pro Fahrrad (inklusive E-Bikes) lag 2020 bei 1.279 Euro. Der Zweirad-Industrie-Verband: “Das hohe Qualitäts- und Sicherheitsbewusstsein der Kunden sorgt dafür, dass Fahrräder und E-Bikes in immer höherer Güte und Ausstattung gekauft werden.”
Der Fahrradbestand in Deutschland ist nach Einschätzung des ZIV auf 79,1 Millionen Stück angewachsen. Darin enthalten sind zirka 7,1 Millionen E-Bikes. ZIV-Geschäftsführer Ernst Brust: “Das vergangene Jahr war beispiellos für die deutsche und internationale Fahrradindustrie sowie für die Fahrradwirtschaft insgesamt. Dass Radfahren relevanter ist denn je, zeigte sich gerade während der Corona-Pandemie noch einmal sehr deutlich.”
Rudolf Huber / glp