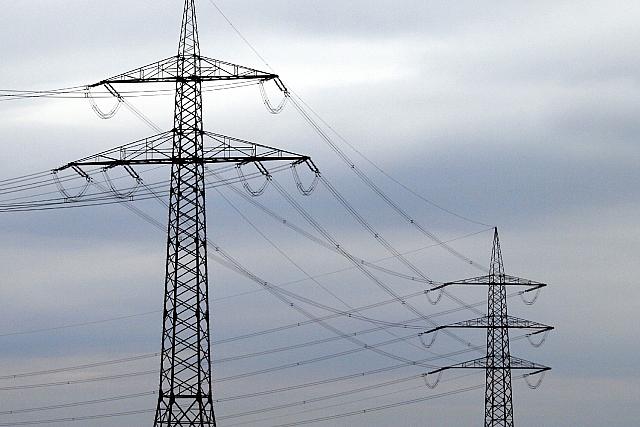Im Jahresdurchschnitt 2024 sind rund 46,1 Millionen Menschen mit Arbeitsort in Deutschland erwerbstätig gewesen. Das waren so viele Erwerbstätige wie noch nie seit der Wiedervereinigung im Jahr 1990, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag mit. Die jahresdurchschnittliche Zahl der Erwerbstätigen stieg gegenüber dem Vorjahr um 72.000 Personen (+0,2 Prozent).
Mit Ausnahme des Corona-Jahres 2020 wuchs die Erwerbstätigenzahl damit seit 2006 durchgängig. Allerdings verlor der Anstieg seit Mitte des Jahres 2022 deutlich an Dynamik): Nach dem Rückgang zu Beginn der Coronakrise im Jahr 2020 um 325.000 Personen (-0,7 Prozent) war die Erwerbstätigenzahl im Jahr 2021 zunächst leicht um 87.000 (+0,2 Prozent) und im Jahr 2022 insgesamt kräftig um 622.000 Personen (+1,4 Prozent) gestiegen. Im Jahr 2023 war der Zuwachs mit 336.000 Personen (+0,7 Prozent) nur noch halb so stark wie im Vorjahr und schwächte sich im Jahr 2024 weiter deutlich ab.
Ursächlich für die Beschäftigungszunahme waren im Jahr 2024 wie bereits in den Vorjahren die Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte und eine gestiegene Erwerbsbeteiligung der inländischen Bevölkerung. Diese beiden Wachstumsimpulse überwogen die dämpfenden Effekte des demografischen Wandels, die zum verstärkten Ausscheiden der geburtenstarken Jahrgänge aus dem Erwerbsleben führen.
Im Jahr 2024 trugen ausschließlich die Dienstleistungsbereiche zum Anstieg der Erwerbstätigenzahl bei. 75,5 Prozent aller Erwerbstätigen arbeiteten 2024 in den Dienstleistungsbereichen (2023: 75,3 Prozent). Die Zahl der Beschäftigten wuchs im Vorjahresvergleich um 153.000 Personen (+0,4 Prozent) auf 34,8 Millionen.
Innerhalb der Dienstleistungsbereiche entwickelte sich die Beschäftigung allerdings unterschiedlich: Einen großen Zuwachs gab es wie in den Vorjahren im Bereich Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit mit +184.000 Personen (+1,5 Prozent). Demgegenüber ging bei den Unternehmensdienstleistern, zu denen auch die Arbeitnehmerüberlassung zählt, die Erwerbstätigkeit erstmals seit 2020 wieder zurück (-55.000 Personen; -0,9 Prozent).
Geringe Zunahmen gab es in den Bereichen Finanz- und Versicherungsdienstleistungen (+12.000 Personen; +1,1 Prozent) sowie Information und Kommunikation (+6.000 Personen; +0,4 Prozent), während die Zahl der Erwerbstätigen im Bereich Handel, Verkehr, Gastgewerbe mit -1.000 Personen (0,0 Prozent) nahezu unverändert gegenüber dem Vorjahr blieb.
Außerhalb des Dienstleistungsbereichs nahm die Beschäftigung ab, so die Statistiker weiter. Im Produzierenden Gewerbe (ohne Baugewerbe) sank die Erwerbstätigenzahl 2024 um 50.000 (-0,6 Prozent) auf 8,1 Millionen Personen. Im Baugewerbe ging mit einem Rückgang um 28.000 Erwerbstätige (-1,1 Prozent) auf 2,6 Millionen der seit dem Jahr 2009 andauernde und nur im Jahr 2015 unterbrochene Aufwärtstrend zu Ende. Insgesamt arbeiteten damit 23,3 Prozent aller Erwerbstätigen im Jahr 2024 im Produzierenden Gewerbe (2023: 23,5 Prozent).
Im Bereich Land- und Forstwirtschaft, Fischerei waren 3.000 Personen weniger erwerbstätig als im Vorjahr, was einem Rückgang um 0,5 Prozent auf 569.000 Personen entspricht. Damit setzte sich der negative Trend der vergangenen Jahre fort.
Entscheidend für die insgesamt positive Entwicklung auf dem deutschen Arbeitsmarkt war die Zahl der Arbeitnehmer, die im Jahresdurchschnitt 2024 um 146.000 Personen (+0,3 Prozent) auf 42,3 Millionen wuchs. Zu diesem Anstieg trug maßgeblich die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung bei. Leichte Verluste gab es hingegen bei der Zahl der marginal Beschäftigten. Bei den Selbstständigen einschließlich mithelfender Familienangehöriger setzte sich im Jahr 2024 der nunmehr seit 2012 andauernde Abwärtstrend fort: Ihre Zahl sank gegenüber 2023 um 74.000 Personen (-1,9 Prozent) auf 3,8 Millionen.
Die Zahl der Erwerbslosen in Deutschland stieg nach vorläufigen Schätzungen der Statistiker auf Basis der Arbeitskräfteerhebung im Jahresdurchschnitt 2024 im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 179.000 Personen oder 13,4 Prozent auf 1,5 Millionen. Die Zahl der aktiv am Arbeitsmarkt verfügbaren Erwerbspersonen, definiert als Summe der Erwerbstätigen und Erwerbslosen, stieg im gleichen Zeitraum um 260.000 Personen (+0,6 Prozent) auf 47,4 Millionen. Die Erwerbslosenquote, gemessen als Anteil der Erwerbslosen an der Zahl der Erwerbspersonen, stieg gegenüber dem Vorjahr von 2,8 Prozent auf 3,2 Prozent.
red