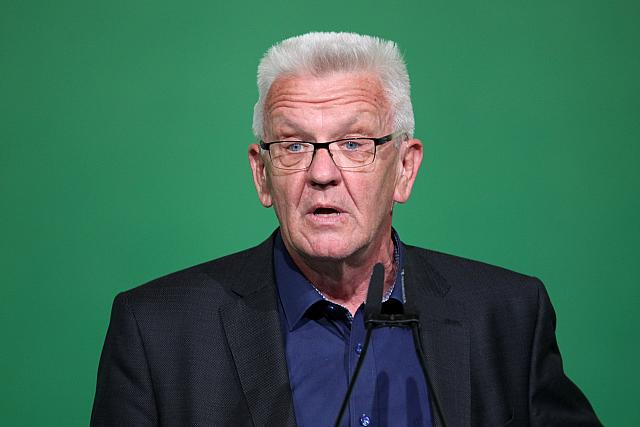Mehrere Bundesministerien haben eine gemeinsame Aktion zur befristeten Anstellung von ausländischen Hilfskräften an deutschen Flughäfen angekündigt. Er nehme die Situation ernst und wolle den Bürgern helfen, sagte Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) der “Bild am Sonntag”. Gemeinsam mit Innenministerin Nancy Faeser (SPD) und Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) werde er deshalb die Personalengpässe an deutschen Flughäfen “abstellen und eine temporäre Lösung präsentieren”.
Wie diese Lösung aussehen wird, konkretisierte Heil: “Die Bundesregierung plant, die Einreise von dringend benötigtem Personal aus dem Ausland für eine vorübergehende Tätigkeit in Deutschland zu ermöglichen.” Dabei wolle man jede Form von Sozialdumping und Ausbeutung ausschließen. “Die Arbeitgeber müssen Tariflohn zahlen und für die befristete Zeit anständige Unterkünfte bereitstellen.”
Faeser ergänzte: “Wir werden ermöglichen, dass Hilfskräfte aus dem Ausland zum Beispiel bei der Gepäckabfertigung eingesetzt werden.” Dabei gelte für sie als Innenministerin: “Bei der Sicherheit gibt es keine Abstriche.” Sie sei der Bundespolizei sehr dankbar, dass sie mit so “massivem Personaleinsatz” dafür sorge, dass wir alle sicher fliegen könnten.
Aktuell fehlen nach Informationen der “Bild am Sonntag” aus Regierungskreisen 2.000 bis 3.000 Mitarbeiter an den Flughäfen. Ziel sei demnach, eine vierstellige Zahl an Fachkräften aus der Türkei nach Deutschland zu holen, die bestenfalls schon ab Juli für einige Monate eingesetzt werden können. Die Gewerkschaft der Polizei begrüßte den Vorstoß der Bundesregierung.
Bei der Luftsicherheitskontrolle dürften jedoch nur “qualifizierte und zertifizierte Kräfte” eingesetzt werden, sagte Arnd Krummen, Vorstand Gewerkschaft der Polizei (Abteilung Bundespolizei) in NRW, der “Westdeutschen Allgemeinen Zeitung” (Montagsausgabe). “Wichtig ist, dass die ganze Kette reibungslos funktioniert, vom Check-in bis zum Verlassen des Gates zum Flugzeug.” Wenn diese Kette an einer Stelle hake, zum Beispiel bei der Gepäckabfertigung, setze das auch die Sicherheitskontrolle unter Druck, so Krummen.
Es bleibe aber bei der Forderung: “Die Luftsicherheit gehört in altbewährter Form wieder in die Hände der Bundespolizei und darf nicht weiter von den Interessen gewinnorientierter Unternehmen abhängen.”
red