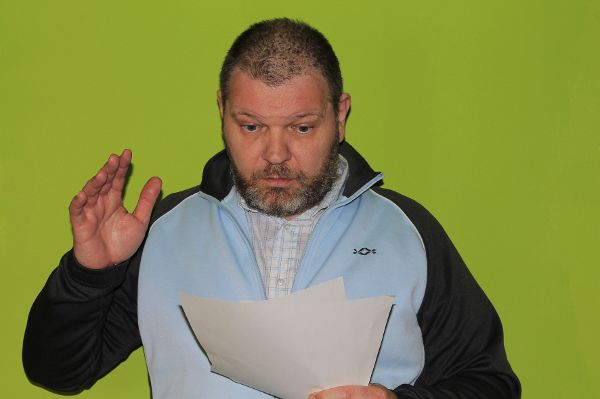Berlin (dts) – Trotz des andauernden Pflegenotstands und trotz gestiegener Belastungen etwa in der Corona-Pandemie haben sich die Verdienste des Personals in Kliniken und Heimen zuletzt nur wenig verbessert. Das ergibt sich aus Auswertungen des Statistischen Bundesamtes, über welche die “Neue Osnabrücker Zeitung” berichtet. Demnach hatten Vollzeitbeschäftigte in Krankenhäusern in der mittleren Leistungsgruppe 3 im zweiten Quartal 2021 einen durchschnittlichen Monatsbruttoverdienst von 3.740 Euro (ohne Sonderzahlungen).
Zum Vergleich: Im zweiten Quartal 2019 waren es 3.498 Euro. Binnen zwei Jahren sind also 242 Euro hinzugekommen, der Bruttostundenlohn stieg um 1,50 Euro. In Heimen erhöhte sich die durchschnittliche Bezahlung von Fachkräften der Leistungsgruppe 3 im selben Zeitraum um 208 auf 3.429 Euro; pro Arbeitsstunde betrug das Plus 1,30 Euro.
Die Lohnsteigerungen für Pflegekräfte in Kliniken und Heimen seien kein ausreichender Dank für die Belastungen in drei Corona-Wellen, sagte Linksfraktionschef Dietmar Bartsch, der die Verdienststatistiken angefragt hatte, der NOZ. Er kritisierte: “Nach zwei Jahren etwa 1,50 Euro brutto mehr Stundenlohn ist beschämend wenig. Das verschärft den Pflegenotstand und kostet faktisch Intensivplätze. Wen wundert es, dass viele Pflegekräfte den Beruf verlassen?” Bartsch forderte: “Wir sollten Pflegekräfte zu Gutverdienern des Landes machen, um möglichst viele Aussteiger zurückzugewinnen.”
Kurzfristig brauche es “mindestens 500 Euro mehr Grundgehalt für Pflegekräfte plus einen kompletten Ausgleich der Inflation”. DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel forderte in der NOZ eine “angemessene tarifvertraglich abgesicherte Entlohnung, die auch gegenüber anderen, weitaus stressärmeren Branchen konkurrenzfähig ist”. Zudem müssten die Rahmenbedingungen verbessert werden.
Das bedeutet nach ihren Worten mehr Zeit mit den Patienten, eine bessere personelle Ausstattung und eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Piel beklagte, seit Beginn der Pandemie im März 2020 hätten bis Frühjahr 2021 rund 9.000 Pflegekräfte gekündigt, Tendenz steigend. “Gründe dafür sind die ständige Überlastungssituation, Personal-Unterdeckung, Gefährdung der eigenen Gesundheit – teils fehlte es sogar an der notwendigen Schutzkleidung – sowie Gefährdung der eigenen Familie und der permanente Stress.”