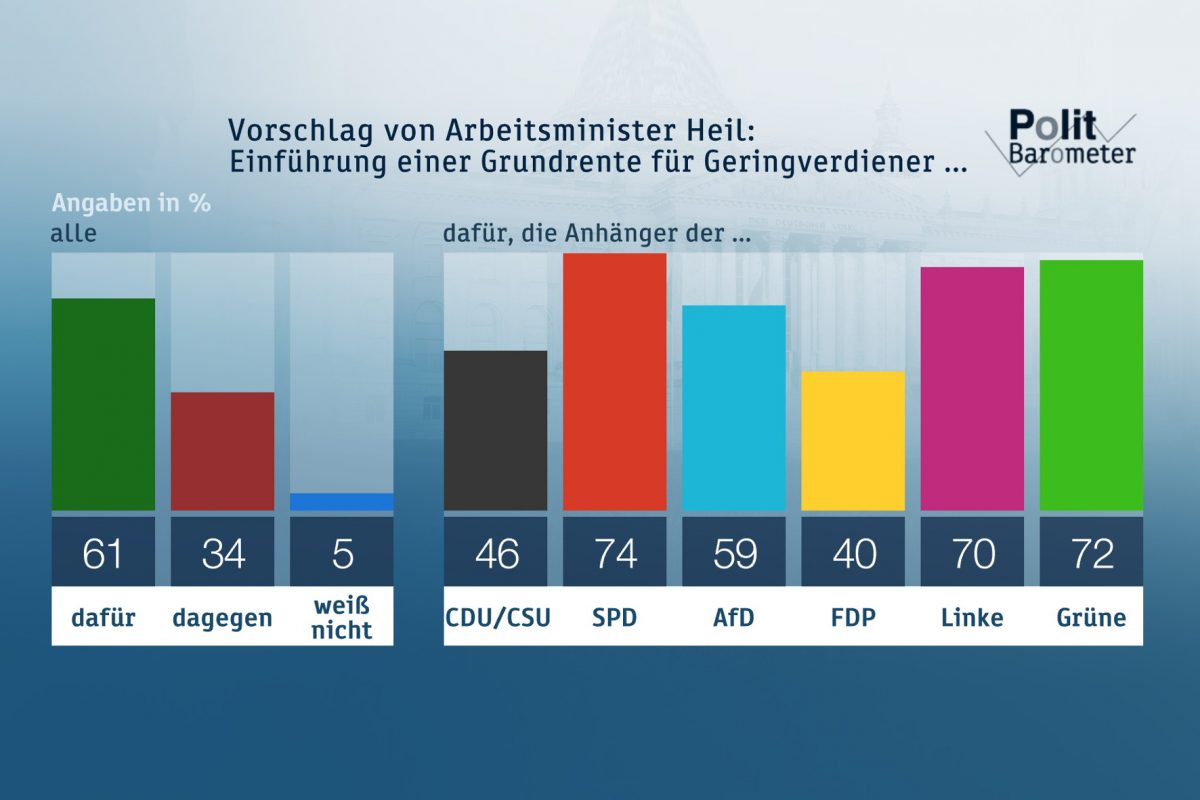Wie viel Sozialabgaben verträgt die Wirtschaft? Diese Frage sorgt immer wieder für Streit zwischen den Sozialpartnern untereinander und den politischen Parteien in Deutschland. Aus Arbeitgebersicht ist die Antwort klar: 40 Prozent.
So lautet die Forderung der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände. “Neben dem Fachkräftemangel gehört zu den zentralen Herausforderungen die Zukunftsfähigkeit unserer Sozialsysteme. Als Arbeitgeberpräsident fordere ich, eine Sozialabgabenbremse bei 40 Prozent gesetzlich festzuschreiben”, sagt Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer und kritisiert die Pläne der SPD, ein Recht auf Arbeit einzuführen und den Mindestlohn auf 12,00 Euro anzuheben. Damit würden Rücklagen aufgebraucht und die Arbeitgeberseite unnötig belastet. Und ein Recht auf Arbeit habe bereits in der DDR nicht funktioniert.
Einzelhändler und Handwerker, Mittelständler und Hidden Champions, Selbstständige Berufe und deutsche Weltkonzerne würden unter der Abkehr der erfolgreichen Sozial- und Wirtschaftspolitik leiden, und auch die Eingliederung von Arbeitslosen würde erschwert, fürchtet Kramer. wid/Mst