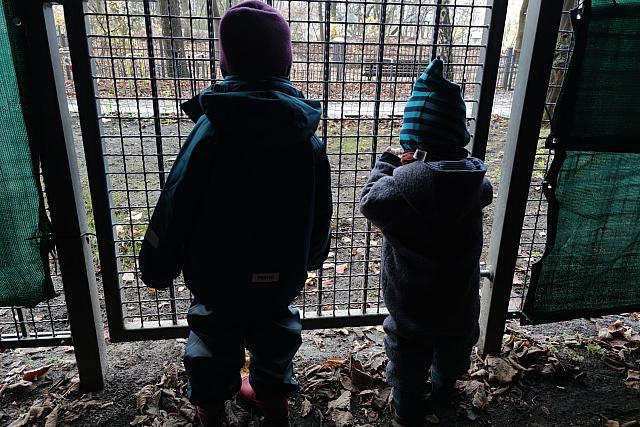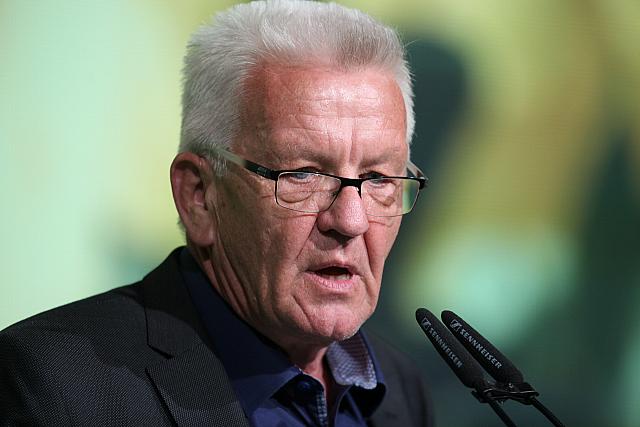Familienministerin Lisa Paus (Grüne) hat erstmals dargelegt, um welche Punkte sich der Streit der Ampel-Koalitionäre über die Kindergrundsicherung dreht. Man sei sich uneinig über das künftige Existenzminimum von Kindern, die in der Ampel vereinbarte Neuberechnung des Minimums bedeute, dass die staatlichen Leistungen höher ausfallen müssten, sagte Paus der “Süddeutschen Zeitung” (Freitagsausgabe). Die Frage sei, wie hoch.
Man habe im Koalitionsvertrag verankert, dass das soziokulturelle Existenzminimum von Kindern neu definiert werde. “Das bedeutet im Ergebnis, dass der sogenannte Zusatzbetrag in der neuen Kindergrundsicherung, den ärmere Familien zusätzlich zum heutigen Kindergeld erhalten sollen, höher ausfallen wird”, sagte Paus. Zudem gehe es um die Frage, wie die Erwerbsanreize gestärkt würden.
Bisher ist es so, dass Familien ein Großteil ihres zusätzlich verdienten Geldes bei den Sozialleistungen abgezogen werde, manchmal sogar alles. “Das müssen wir ändern, damit sich Arbeit stärker lohnt. Wir wissen, wie wichtig diese Anreize sind”, sagte Paus.
“Sie zahlen sich langfristig aus, aber zunächst einmal verursachen sie dem Staat Kosten. Auch das ist ein Milliardenbetrag, der bisher strittig ist.” Mit zusätzlichen Kosten in Milliardenhöhe rechnet Paus dadurch, dass mehr Berechtigte die ihnen zustehende Leistung tatsächlich erhalten sollen.
Christian Lindner hatte diese kürzlich mit “zwei bis drei Milliarden Euro” beziffert. Bisher nehmen viele Menschen die Hilfen nicht in Anspruch, weil ihnen die Antragstellung zu kompliziert ist oder sie nichts von der Unterstützungsmöglichkeit wissen. “Meine Experten schätzen die Mehrkosten allein dafür auf bis zu fünf Milliarden Euro”, sagte die Grünenpolitikerin.
“Dazu kommen Anreize für die Arbeitsaufnahme, moderate Leistungsverbesserungen und die Kosten für die Digitalisierung, die sehr anspruchsvoll ist. Deswegen habe ich für die Kindergrundsicherung insgesamt zwölf Milliarden Euro ab 2025 angemeldet”, sagte Paus. “Die endgültige Zahl steht erst fest, wenn wir die inhaltliche Ausgestaltung der Kindergrundsicherung geklärt haben.”
Die Ministerin und FDP-Chef Lindner streiten seit Wochen öffentlich über die Ausgestaltung und die Finanzierung der Kindergrundsicherung.
red