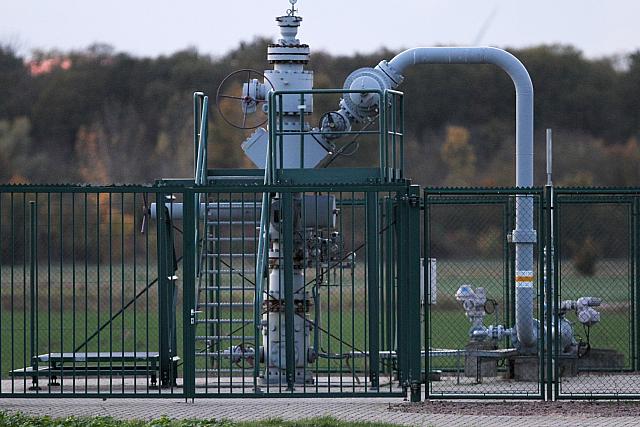Nach dem vorläufigen Scheitern der “Bürgergeld”-Reform im Bundesrat zeigt sich Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) zuversichtlich, im Vermittlungsausschuss eine Einigung zu erzielen. Der sei eine Chance, sagte Lindner am Montag RTL/ntv. “Der Vermittlungsausschuss kann das Bürgergeld noch besser machen. Ich habe nichts dagegen, wenn die Arbeitsanreize vergrößert werden, etwa durch Verbesserungen bei den Zuverdienstmöglichkeiten oder auch noch mehr Klarheit bei den Mitwirkungspflichten, also bei den Sanktionen.” Das “Bürgergeld” sei ein Kompromiss der Ampelkoalition gewesen. “Der wird jetzt im Vermittlungsausschuss noch mal aufgemacht und ich hoffe jetzt natürlich verbessert. Anliegen der FDP sind, bei den Zuverdienstgrenzen etwas zu verbessern. Und wenn wir noch mehr Klarheit schaffen, dass eine soziale Leistung auch Mitwirkung voraussetzt, wenn wir das noch stärken, dann wird das Bürgergeld noch besser.”
red