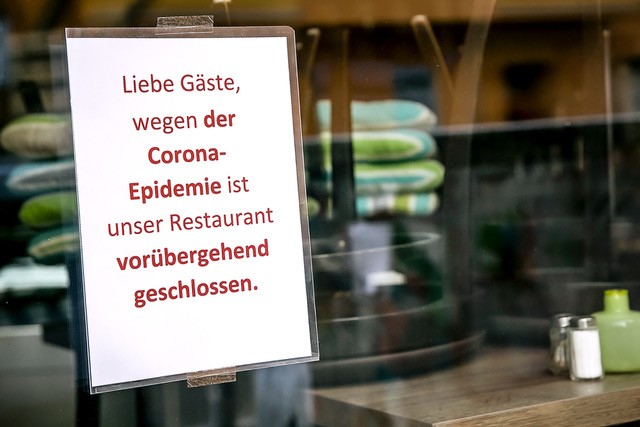Die Bundesregierung rechnet für den kommenden Winter mit regionalen Gasnotlagen. Laut eines Berichts der “Bild” (Montagausgabe) wurde das den Chefs der Staatskanzleien der Länder bei einer Krisen-Konferenz mit Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt (SPD) mitgeteilt. Demnach geht die Bundesregierung davon aus, dass Russland nach den Wartungsarbeiten an der Pipeline Nord Stream 1 erneut Vorwände anführen wird, um die Gaslieferungen zu drosseln.
Dass Russland die Gaslieferungen auf über 40 Prozent der vereinbarten Liefermengen erhöht, betrachtet die Bundesregierung als unrealistisch. Sollte Russland jedoch wider Erwarten 40 Prozent der Gasmengen liefern, käme Deutschland ohne Notlagen durch den kommenden Winter. Zudem rechnet die Bundesregierung damit, dass die Gasabhängigkeit von Russland auch bis zum Winter 2023/24 nicht beendet werden könne.
Laut “Bild”-Bericht geht die Bundesregierung davon aus, dass die Gaspreise um das Doppelte bis Dreifache ansteigen werden. Falls Russland seine Gaslieferungen nach den Wartungsarbeiten nicht wieder aufnimmt, soll eine Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) einberufen werden.
red