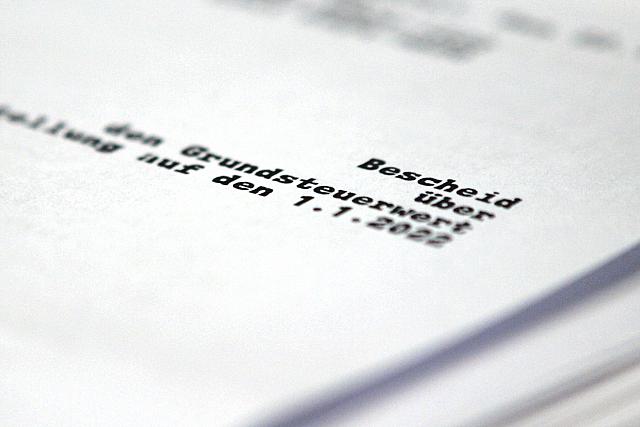Vor der Verabschiedung des Heizungsgesetzes hat die Bundesnetzagentur vor Kostenfallen durch Gas- und Ölheizungen gewarnt. “Ganz allgemein raten wir davon ab, jetzt Investitionen vorzuziehen und noch schnell eine fossile Heizung einzubauen. Das wird auf lange Sicht teuer”, sagte ein Sprecher der Agentur der “Neuen Osnabrücker Zeitung” (Freitagausgaben).
Er dämpfte zugleich die Hoffnung, Gasheizungen könnten bald mit Wasserstoff betrieben werden. “Mit Wasserstoff privat heizen wird eher vereinzelt eine Option sein”, so der Behördensprecher. “Dass Wasserstoff in Deutschland in der Nutzung im privaten Wärmebereich erschwinglich und verfügbar sein wird, erwartet bisher keiner der Experten.”
Die Bundesnetzagentur verwies auf das Ziel der Bundesregierung, dass Deutschland spätestens 2045 klimaneutral sein solle. “Diese Perspektive muss allen Hauseigentümern klar sein.” Die Bundesregierung rief der Sprecher auf, “die Menschen nicht vor vollendete Tatsachen zu stellen, sondern eine geordnete und transparente Planung auf den Weg zu bringen, bei der die Perspektiven und die zeitlichen Abläufe klar werden.”
Bürgern empfiehlt die Behörde, alle Möglichkeiten gründlich durchzurechnen. “Wir raten, die Wärmepläne der eigenen Kommune zu erfragen, sich einen Energieberater zu suchen und die verschiedenen Optionen mit spitzem Bleistift prüfen zu lassen”, sagte der Sprecher.
red