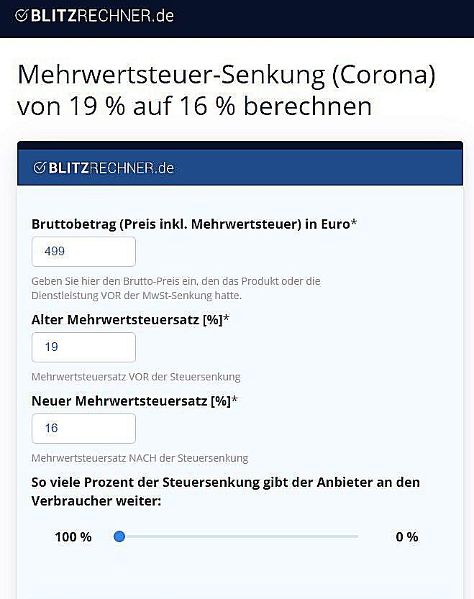Es scheint paradox: Trotz stagnierender Inflationsrate steigen die Lebensmittelpreise. Um deren Entwicklung besser zu veranschaulichen, haben Wirtschaftswissenschaftler von der Universität Hohenheim in Stuttgart den “Chili-con-Carne-Index” entwickelt. Die Forscher hatten bereits Mitte April 2020 einen Preisanstieg von 6,0 Prozent speziell für dieses Gericht errechnet.
Preistreiber war dabei vor allem das Gemüse. So stiegen die Preise für Paprika um fast 15 Prozent, für Mais um 14 Prozent und für Tomaten um rund 13 Prozent, während der Preisanstieg für Hackfleisch eher moderat ausfiel.
Für ihre Analyse beobachten die Wirtschaftswissenschaftler seit Februar 2020 die Preisentwicklung der Online-Angebote großer europäischer Supermarktketten. “Sollte die Teuerungsrate konstant so hoch bleiben, müssen Verbraucher damit rechnen deutlich tiefer in die Tasche greifen zu müssen”, heißt es in der Studie.
Mit ihrer Analyse beleuchten die Wissenschaftler ein Detail, das in Inflations-Statistiken weniger im Fokus steht. Deren Grundlage für die Berechnung der Teuerungsrate ist der sogenannte “Warenkorb”. Das ist ein Bündel von Gütern und Dienstleistungen, dessen Zusammensetzung aus dem Konsum der Verbraucher in der Vergangenheit abgeleitet ist.
Doch durch die Corona-Krise hat sich das Konsumverhalten der Menschen verändert: Es sei zu befürchten, dass sich die Preissteigerungsrate für Haushalte mit niedrigerem Einkommen deutlich von der anhand des Warenkorbs ermittelten Inflationsrate unterscheidet, vermuten die Ökonomen der Universität Hohenheim. Dies sei darauf zurückzuführen, dass Lebensmittel mit gerade bei wirtschaftlich schwächeren Haushalten einen überdurchschnittlich hohen Anteil des üblichen Konsums ausmachen.
Um die unterschiedliche Entwicklung zu veranschaulichen, haben die Wissenschaftler den “Chili-con-Carne-Index” eingeführt. Dieses Gericht ist nicht nur bei Studenten besonders beliebt und kann leicht nachgekocht werden. In dem Warenkorb wurden etwa 70 Produkte zusammengestellt, die als Zutaten für die Herstellung dieses Gerichts Verwendung finden können. Dieser Warenkorb mache Inflation für den Normalverbraucher regelrecht “erlebbar”.
Lars Wallerang