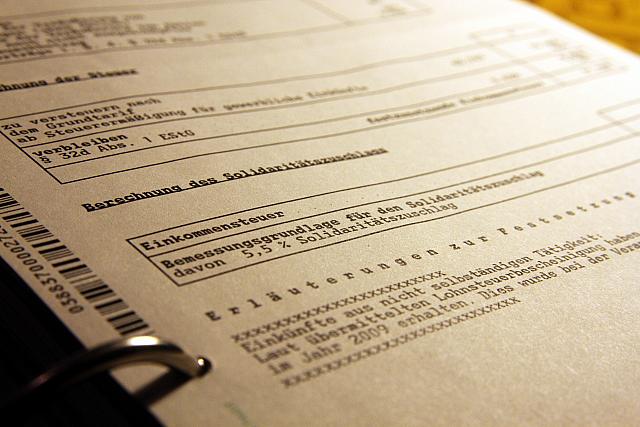Dieselkraftstoff ist in Deutschland mittlerweile wieder teurer als vor der Einführung des sogenannten Tankrabatts. Ein Liter Diesel kostet aktuell im Bundesschnitt 2,050 Euro und damit 0,6 Cent mehr als am 31. Mai, teilte der ADAC am Mittwoch mit. Gegenüber der Vorwoche stieg der Dieselpreis um 1,4 Cent.
Rein steuertechnisch beträgt der Abschlag seit dem 1. Juni beim Diesel rund 17 Cent je Liter. Ein Liter Super E10 kostet im bundesweiten Mittel derzeit 1,893 Euro. Das sind 5,1 Cent weniger als in der Vorwoche.
Beim Benzin bleibt auch noch etwas vom Tankrabatt übrig. Am letzten Mai-Tag hatte ein Liter E10 noch im Schnitt 2,151 Euro gekostet.
red