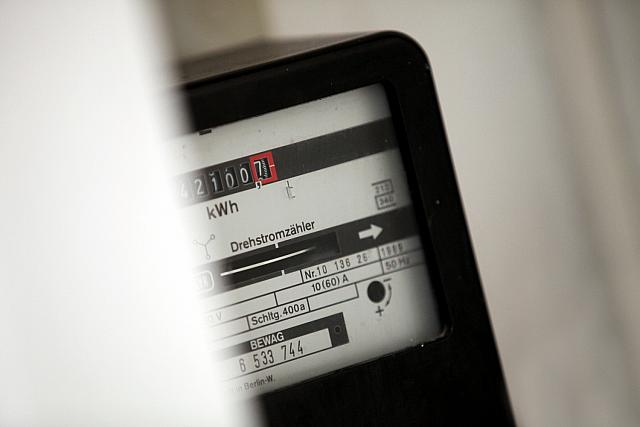Das Auswärtige Amt hat eine Reisewarnung für den Iran ausgesprochen. “Für deutsche Staatsangehörige besteht die konkrete Gefahr, willkürlich festgenommen, verhört und zu langen Haftstrafen verurteilt zu werden”, teilte die Behörde mit. Vor allem Doppelstaater, die neben der deutschen auch noch die iranische Staatsangehörigkeit besitzen, seien gefährdet.
“In jüngster Vergangenheit kam es zu einer Vielzahl willkürlicher Verhaftungen ausländischer Staatsangehöriger”, schreibt das Auswärtige Amt weiter. Bei Protesten und Kundgebungen könne es seitens der Sicherheitskräfte zur Anwendung von unverhältnismäßiger Gewalt und willkürlichen Festnahmen kommen. “Internetdienste, vor allem Soziale Medien und Telefonnetze, können zeitweilig abgestellt werden. Personen, die sich beabsichtigt oder zufällig im Umfeld von Demonstrationen aufhalten droht Festnahme und Verurteilung”, warnt die Behörde. “Alle Ausländer sowie insbesondere Personen, die auch die iranische Staatsangehörigkeit besitzen, unterliegen einem erhöhten Risiko, auch ohne erkennbaren Grund festgenommen oder bei Ein- und Ausreise zurückgewiesen zu werden.” Iranische Behörden würden keine doppelte Staatsangehörigkeit anerkennen, sondern behandelten iranische Doppelstaater als wären sie ausschließlich iranische Staatsangehörige, hieß es.
Konsularische Unterstützungsmöglichkeiten durch die Deutsche Botschaft Teheran seien “erheblich eingeschränkt bis unmöglich”. Fotografieren und Filmen könne zu Missverständnissen bis hin zu Spionageverdacht führen, hieß es weiter. In der Vergangenheit habe die Polizei entsprechende Personen aufgehalten und Kameras, Handys oder Speichermedien konfisziert.
red