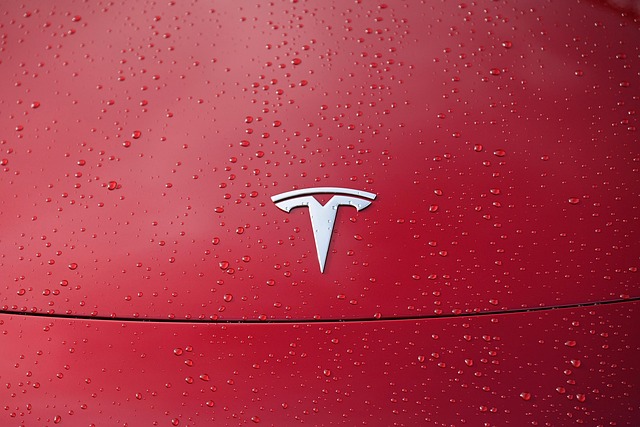Berlin – Die öffentlichen Kassen in Deutschland haben im April deutlich mehr eingenommen als im Vorjahresmonat. Laut Bundesfinanzministerium lagen die Steuereinnahmen um rund zehn Prozent höher – maßgeblich getrieben durch einen starken Anstieg bei der Erbschaftsteuer. Auch im ersten Quartal insgesamt zeigt sich ein robustes Steuerplus. Doch nicht alle Bereiche legten zu: Die Einnahmen aus der Energiesteuer und Stromabgaben gingen zurück.
Für das erste Quartal zusammen bedeutet das ein Plus von 9,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 286,3 Milliarden Euro. Dem Bericht zufolge trug maßgeblich ein Einmaleffekt bei den Ländersteuern zu dem Anstieg im April bei. Der extrem hohe Anstieg des Aufkommens aus den Ländersteuern von über 191,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat ging demnach auf die Erbschaftsteuer zurück. Bei dieser lagen die Einnahmen maßgeblich durch einen einmaligen Effekt fast 500 Prozent höher als im April 2024. Bei der Grunderwerbsteuer, der zweiten aufkommensstarken Ländersteuer, war ein Plus von 25 Prozent zu verzeichnen.
Der Aufkommenszuwachs bei den Gemeinschaftsteuern, aus denen der größte Teil des Steueraufkommens resultiert, fiel mit 4,3 Prozent moderater aus. Ein Plus ergab sich dabei weiterhin bei der Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge. Die Einnahmen aus der Lohnsteuer und der Körperschaftsteuer lagen etwas höher als im April 2024. Im Vergleich zum Vorjahresmonat nahezu unverändert zeigte sich das Aufkommen aus den Steuern vom Umsatz und das aus der veranlagten Einkommensteuer.
Die Einnahmen aus den Bundessteuern legten im April gegenüber dem Vorjahresmonat um 4,7 Prozent zu und damit ebenfalls weniger stark als die Einnahmen insgesamt. Insbesondere verzeichneten die Tabaksteuer, der Solidaritätszuschlag und die Versicherungsteuer Einnahmezuwächse. Dagegen lagen die Einnahmen aus der Energiesteuer, der Kraftfahrzeugsteuer und der Stromsteuer niedriger als im April 2024.