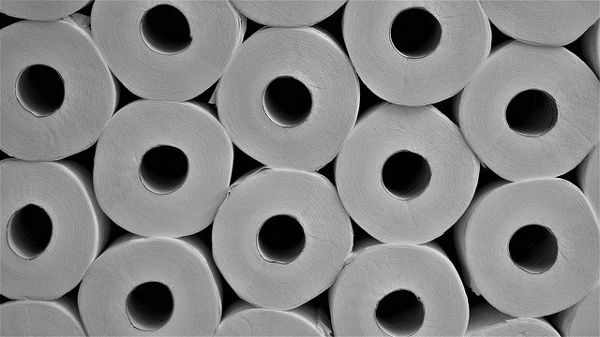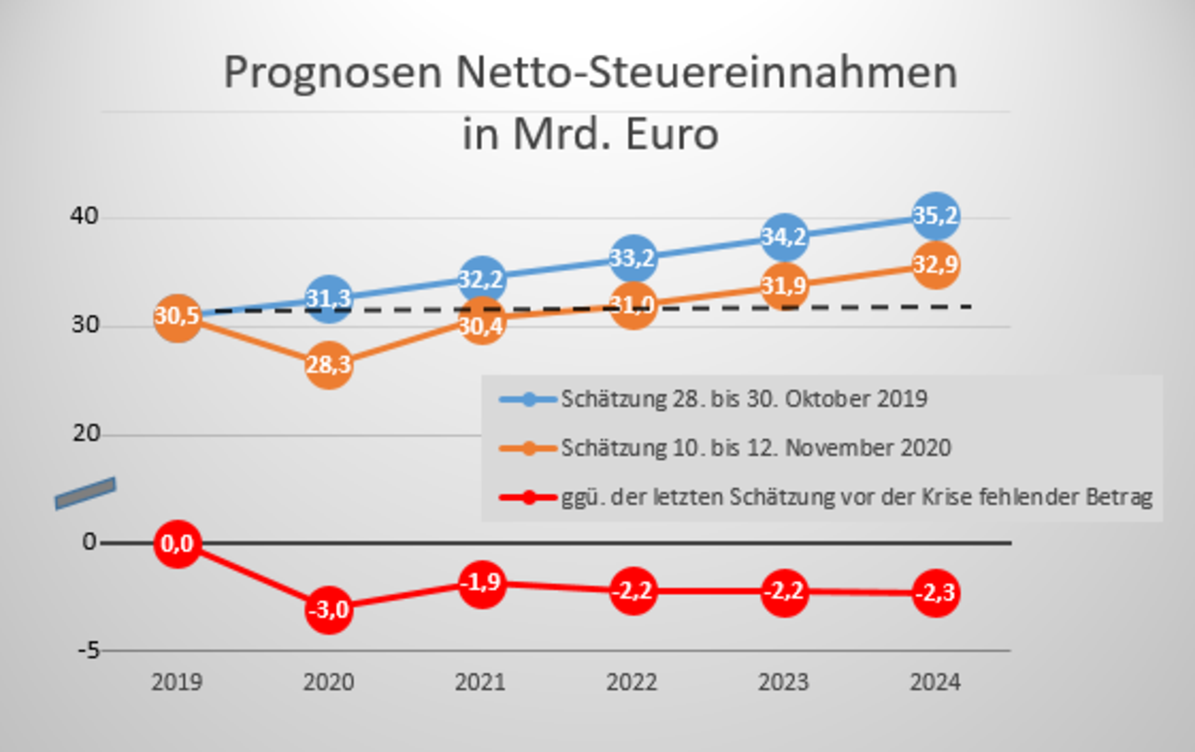Hamsterkäufe und tatsächlich erhöhter Bedarf haben seit dem Beginn der Corona-Krise die Nachfrage nach bestimmten Hygiene- und Alltagsartikeln zeitweise deutlich ansteigen lassen. Das hat das Statistische Bundesamt (Destatis) im Rahmen einer Sonderauswertung festgestellt.
“So lag etwa die Produktion von Desinfektionsmitteln im Durchschnitt von Januar bis September 2020 um 80 Prozent über der des Vorjahreszeitraums”, heißt es bei der Behörde. Die Unternehmen in Deutschland mit 50 und mehr Beschäftigten hätten schon mit Ausbruch der Corona-Pandemie auf die veränderte Nachfrage reagiert: Während die Produktion von Desinfektionsmittel im Januar 2020 bereits 29 Prozent über dem Vorjahresmonat lag, erreichte sie im April den bisherigen Jahreshöhepunkt: mit 14.800 Tonnen Wirkstoffgewicht wurde 161 Prozent mehr produziert als im Vorjahresmonat mit rund 5.700 Tonnen.
Deutliche Zuwächse gibt es auch bei den Teigwaren. Im März 2020 wurden mit gut 36.600 Tonnen 72 Prozent mehr Nudeln produziert als im Vormonat. Von Januar bis September 2020 lag die Produktion im Schnitt um 20 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum.
Anders verläuft die Entwicklung beim Toilettenpapier, das anfangs zur heißbegehrten Mangelware wurde. So wurden im März und April 2020 zwar 17 und zwölf Prozent mehr Toilettenpapier produziert als in den Vorjahresmonaten. Insgesamt war die Menge des produzierten Hygieneprodukts von Januar bis September 2020 mit 85.300 Tonnen jedoch leicht rückläufig – viele Konsumenten konnten offenbar lange aus üppigen Reserven schöpfen.
Rudolf Huber / glp